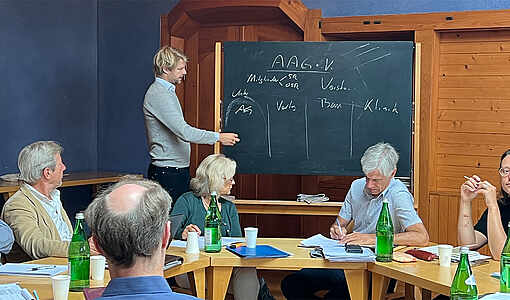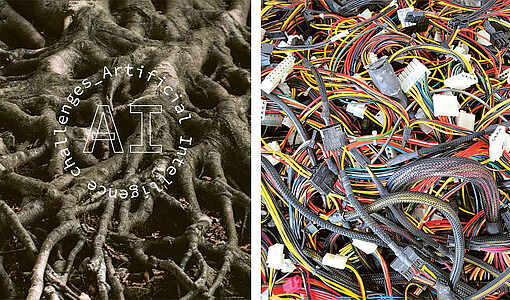Rein innerlich geschaute Formen Betrachtungen zum Lebensgang Rudolf Steiners V
»Und trotz alledem habe ich verhältnismäßig früh gut lesen gelernt. Dadurch konnte der Hilfslehrer mit etwas in mein Leben eingreifen, das für mich richtunggebend geworden ist. Bald nach meinem Eintreten in die Neudörfler Schule entdeckte ich in seinem Zimmer ein Geometriebuch. Ich stand so gut mit diesem Lehrer, daß ich das Buch ohne weiteres eine Weile zu meiner Benutzung haben konnte. Mit Enthusiasmus machte ich mich darüber her. Wochenlang war meine Seele ganz erfüllt von der Kongruenz, der Ähnlichkeit von Dreiecken, Vierecken, Vielecken; ich zergrübelte mein Denken mit der Frage, wo sich eigentlich die Parallelen schneiden; der pythagoreische Lehrsatz bezauberte mich.

»Und trotz alledem habe ich verhältnismäßig früh gut lesen gelernt. Dadurch konnte der Hilfslehrer mit etwas in mein Leben eingreifen, das für mich richtunggebend geworden ist. Bald nach meinem Eintreten in die Neudörfler Schule entdeckte ich in seinem Zimmer ein Geometriebuch. Ich stand so gut mit diesem Lehrer, daß ich das Buch ohne weiteres eine Weile zu meiner Benutzung haben konnte. Mit Enthusiasmus machte ich mich darüber her. Wochenlang war meine Seele ganz erfüllt von der Kongruenz, der Ähnlichkeit von Dreiecken, Vierecken, Vielecken; ich zergrübelte mein Denken mit der Frage, wo sich eigentlich die Parallelen schneiden; der pythagoreische Lehrsatz bezauberte mich.
Daß man seelisch in der Ausbildung rein innerlich angeschauter Formen leben könne, ohne Eindrücke der äußeren Sinne, das gereichte mir zur höchsten Befriedigung. Ich fand darin Trost für die Stimmung, die sich mir durch die unbeantworteten Fragen ergeben hatte. Rein im Geiste etwas erfassen zu können, das brachte mir ein inneres Glück. Ich weiß, daß ich an der Geometrie das Glück zuerst kennen gelernt habe.«[1]
In den Betrachtungen des vorangegangenen Essays ›Einsame Fragen‹[2] wurde das erwachende Geisterleben des neunjährigen Rudolf Steiner durch verschiedene Zugänge erschlossen. Die Richtung, in welcher der Knabe einen weiteren Schritt auf diesem Weg suchte, folgte dem Bedürfnis nach einer Rechtfertigung der inneren Erlebnisse und einer Aufhellung von deren innerem Zusammenhang. Der Knabe war in einer durch die Sinneswahrnehmungen geleiteten, vom Verstand erschlossenen und für ihn damit keineswegs befriedigend erklärten Umwelt auf der Suche nach etwas, das in eine sachgerechte Beziehung zu seinem geistigen Erleben gebracht werden konnte und, sollte dies glücken, jene Legitimation geistigen Wahrnehmens leistete, welche der Knabe suchte.
Die Kindheitsjahre in Pottschach erfuhren eine Zäsur durch die Versetzung von Johann Steiner nach Neudörfl. Der reguläre Unterricht in der dortigen Dorfschule enthielt für Rudolf Steiner nichts Förderndes. Die Seele des Knaben wurde davon kaum berührt. Zufällige Ereignisse waren es, die unverhofft in die einsame Welt seiner inneren Fragen vordrangen, um dort etwas zu entfalten, was die Stellung des Knaben zu seinem Geisterleben entscheidend verändern sollte. Das gute Verhältnis zum Hilfslehrer ermöglichte es, das in dessen Zimmer entdeckte Geometriebuch auszuleihen. Die Beschäftigung mit dem Inhalt des Buches führte zu einem Erlebnis, welches die zunächst nur für das Bewusstsein des Knaben fraglichen Geisterlebnisse in einen gerechtfertigten und begründeten Zusammenhang fügte. Die Lektüre des Buches bestand in der inneren Entfaltung geometrischer Vollzüge. Die Stimmigkeit und in sich selbst bestehende Evidenz dieser Vollzüge legitimierte für den Knaben jene Wahrnehmungen, welche für ihn in einer der Geometrie gleichenden Weise erlebt wurden. Diese Evidenz ergab sich aus einem Zusammenfall des innerlich Wahrgenommenen mit dessen inhaltlicher Klarheit. Die einen Erkenntnisvollzug fordernde Trennung zwischen erklärungsbedürftiger Wahrnehmung und deren ausstehendem Verständnis bestand nicht. Dieses Ineins war möglich durch die von sinnlicher Wahrnehmung unabhängige Natur der Geometrie. Gleichwohl war sie nichts Willkürliches, sondern eine wesenhaft bewegte Sprache des Notwendigen. Der Knabe konnte die Natur seiner geistigen Wahrnehmungen und Erlebnisse durch die Geometrie gestützt fühlen. Beides war vergleichbar. Dieses Sich-Gleichen der Natur geometrischen und geistigen Erlebens rief in ihm ein Glückserlebnis hervor.
Geometrie und Glück?
Wie kann ein Zusammenhang von Geometrie und Glück aufgehellt werden? Und noch davor: Was bedeutet beides? Durch
welche Verwandtschaft ergibt sich der Brückenschlag von geometrischem in geistiges Erleben? Was meint Sich-Gleichen, was Ähnlichkeit? – Auch hier ist wieder zu bemerken, wie im Zuge der Lektüre dieser zunächst doch recht klar wirkenden Schilderung Steiners nur ein vermeintliches Verständnis erreicht wird, sofern man nicht innehält und sich die Übertragung eigener und unter Umständen ungeeigneter begrifflicher und vorbegrifflicher Voraussetzungen auf die Schilderungen Steiners untersagt. Andererseits muss die gründliche Erkundung des eigenen Nicht-Verstehens nicht notwendig ins Aporetische führen, so fern man sich über die Form des eigenen Verstehens Klarheit verschafft. Diese ist am meisten dann zu erreichen, wenn es sich um ein erarbeitetes Verständnis handelt, bei dem alle Arbeitsschritte zur Sache des Denkens gemacht werden. Dessen Dienst bestünde dann in einem individuellen, seiner eigenen Perspektive bewussten Verständnis.
Nicht aus zwingenden Gründen, sondern um überhaupt einen Anfang zu machen, möchte ich zunächst nach dem Glück fragen. Wie ließe sich charakterisieren, was hier mit Glück gemeint sein könnte? Sucht man in einer begrifflichen Richtung, so kommt man auf verschiedene Aspekte eines idealen Verhältnisses zwischen Mensch und Welt. Als handelndes Wesen ist der Mensch bestrebt, die Welt nach seinen Bedürfnissen zu gestalten. Dazu muss er seinen Willen betätigen. Dieser steht in einem offenen Verhältnis zum Ziel einer bestimmten Handlung. Ob dieses Ziel tatsächlich erreicht wird, ist nicht gewiss und für die Betätigung des Willens nicht maßgebend. Das Handeln des Menschen in der Welt ist also dadurch bestimmt, dass sein durch Wunsch und Wille bestimmtes jeweiliges Bedürfnis sich nicht notwendig auch durch zielorientiertes Handeln erfüllen lässt. Erfüllt es sich aber, so teilt sich das jeweilige Wollen in Form der geglückten Handlung der Welt mit. Etwas vom wollenden Wesen hat sich der Welt eingeprägt und ist an diese übergegangen. Glück wäre demnach, dass das durch den Willen in der Welt Bewirkte dem Wunsch entspricht. Kann dies nicht erreicht werden, so wird die versagte Einheit zwischen Wunsch und Wille als unzureichend erlebt. Im Willen leben das Bestreben und die Bereitschaft fort, durch weiteres Handeln einen neuen Versuch zu unternehmen. Glück kann also nur durch ein Handeln hervorgerufen werden, dass sich, skeptisch formuliert, der Möglichkeit seines Misslingens aussetzt. Damit der Mensch Glück erfahre, muss er tätig werden.
Zwischen einem bestimmten Wollen und der ihm dienenden Handlung herrscht Ungewissheit, die dazu bestimmt ist, für das handelnde Wesen eine Zwiesprache zwischen Welt und Ich zu entfalten. Ihr Inhalt ist das Wie des Handelns und nicht auf das Glück selbst gerichtet. Ziel einer Handlung kann nicht das Glück selbst, sondern immer nur eine bestimmte Weise des Handelns sein. Die Handlung, damit sie glücke und also die entsprechende Erfahrung gewähre, muss genau beherrscht werden, etwa wie ein gut einstudiertes Klavierstück, dessen Vortrag nur gelingt, wenn die individuellen Voraussetzungen in Form von Fähigkeiten durch Übung gefestigt und vertieft wurden. Im Alltag allerdings bleibt dem Handeln in der Regel keine Zeit für eine übende Vorbereitung, die rechtfertigen würde, vergleichsweise von einer Aufführung zu sprechen. Alltägliches Handeln vollzieht sich eher im Modus permanenten Übens. Vom künstlerischen Handeln kann man indes lernen, dass die Aussicht auf eine gelingende Handlung dann am größten ist, wenn man sich möglichst vollkommen in sie vertieft. Die Handlung kann dann am meisten frei verlaufen, wenn alles Bewusstsein allein in ihrem Vollzug lebt. Eine Zielvorstellung vom Glück würde dabei hinderlich sein und von der Konzentration auf das gegenwärtige Handeln ablenken.
Dies gilt für das alltägliche Handeln deshalb oft nicht, weil mit ihm ein Zweck verfolgt wird und ihm dadurch der Charakter eines Mittels zugewiesen wird. Das Gelingen einer Handlung wird bestimmt vom zu erreichenden Zweck. Die damit verbundene Erfahrung kann insofern nicht als Glück bezeichnet werden, weil gerade die kalkulierte Vorstellung vom Erreichen eines vorgegebenen Zweckes keine Unverfügbarkeit zulässt. Es wäre beim zweckorientierten Handeln also in Bezug auf sein Gelingen oder Misslingen eher von Erfolg oder Misserfolg zu sprechen, nicht aber von Glück. Die Welt als Ort einer zweck- orientierten Handlung kann sich deshalb auch nur als durch den Zweck bestimmtes Entweder-Oder aussprechen, nicht frei. Die Freiheit einer von der Welt kommenden Entgegnung auf das menschliche Handeln kommt nur dem Glück zu. In ihm liegt jene nicht kalkulierbare Offenheit, welche der Welt als dem Ort des menschlichen Handelns quasi einen Subjektstatus zuerkennt. Freilich bleibt dieser peripher-sphärisch und lässt sich nicht personal identifizieren. Gleichwohl ist ein Antwort- Charakter seitens der Welt für die Glückserfahrung bezeichnend. Im Glück bejaht die Welt das Handeln des Subjekts.
Glück und Streben
Dieser Umstand macht die Glückserfahrung zu einer biografischen, welche sich im Zeitverlauf zwischen Geburt und Tod im Zusammenspiel von Ich und Welt als Streben des handelnden Individuums gibt. Wie sich der einzelne Mensch zur Antwort der Welt auf sein Handeln stellt, bildet sein Leben. Daraus aber folgt auch, dass die Glückserfahrung sich nach der Entsprechung zum Streben des individuellen Wesens richtet. Streben aber ist, was sich aus dem Leben der individuellen Seele in der Welt einlösen will, denn die Menschen sind in ihrem Streben verschieden. Was Glück also im Einzelnen bedeutet, kann allgemein nicht festgesetzt werden. Darauf zielt bereits des Aristoteles Bemerkung, Glück sei »ein Tätigsein der Seele im Sinne der ihr wesenhaften Tüchtigkeit«[3].
Dieser Gedanke betont, dass es nicht um ein beliebiges Tätigsein geht, dessen Gelingen lediglich vom Einüben einer sachgemäßen Technik abhinge, sondern es wird auf die tätige Seele als einem durch seine Eigenheit bestimmten Wesen verwiesen, zu dem es gehört, ihm entsprechende Tätigkeiten zu vollziehen, zu denen es geneigt und fähig ist. Dieser Gedanke lässt sich weiterverfolgen zu der Frage: Wie kommt das individuelle menschliche Wesen in seinen Handlungen zur Welt? Und wie tritt die Welt als potenzielle Heimat des individuellen Menschen diesem gegenüber als Ermöglichung für die seiner Seele »wesenhafte Tüchtigkeit«.
Wenden wir uns mit diesem Verständnis von Glück dem zitierten Kindheitserlebnis Steiners zu. Um genauer zu verstehen, warum Steiner das an der Geometrie Erlebte als Glück bezeichnete, muss betrachtet werden, welches Bedürfnis in der kindlichen Seele nach Erfüllung suchte, oder offener formuliert, welche Frage in ihr sich artikulierte – wenn zugestanden wird, dass eine Frage nicht bloß ein zu behebender intellektueller Mangel, sondern die gedankliche Auslegung eines existenziellen Strebens ist. Demnach entspräche die Form, welche der Gedanke in der Frage annimmt, dem in der Welt nach Orientierung für sein Handeln suchenden individuellen Daseinswillen der Geistseele des Knaben. In seiner geistigen Präexistenz war dieser Wille umfassendes Bewusstsein, ungebundenes und unbedingtes schöpferisches Vermögen und zugleich dessen Erfüllung. Mit dem Eintritt in eine eigene körperliche und eine zeit- und milieubestimmte welthaltige Leiblichkeit begann nun eine geschiedene zwiefache Teilhabe – an einer, seit dem Wartesaalerlebnis unbezweifelbaren, Geistwirklichkeit und einer mit dieser nicht kongruenten Leib- und Körperwelt. Wenn Steiner später im Vorwort zur ›Theosophie‹ das Ziel seiner Arbeit in Anknüpfung an Fichte mit dem Erschließen einer Geistwelt als Wirklichkeit angibt, so wendet sich die Frage nach Wirklichkeit für den knapp neunjährigen Knaben genau umgekehrt auf den durch die Sinne zugänglichen Weltinhalt. Es geht also nicht allein um die Frage nach einer geistigen, sondern vordringlich um die nach einer physischen Welt als Wirklichkeit. Sie war das Unbegriffene, das mit dem eigenen Geisterleben nicht in Übereinstimmung zu bringen war. Gleichwohl verbarg sich in dem Geschiedensein in das Zwiefache von geistigem und physischem Erfahrungsreich zugleich auch die Voraussetzung für die Glückserfahrung als zwar noch ausstehende, aber doch mögliche Zustimmung der Welt zum individuellen Daseinsimpuls der eigenen Individualität. Dieser war für den Knaben zumindest so klar, dass er ein Unterscheidungsvermögen für die Erkenntnis einer von der Welt herrührenden Entsprechung zum eigenen Geisterleben wachrief. Wo und wie gibt die Welt mir Antwort auf meine Frage?
Das Kind und sein Ich
Die leiblichen Voraussetzungen für diese Erkenntnisfrage des Knaben fallen im Wesentlichen zusammen mit den in ›Einsame Fragen‹ behandelten. Die universelle Natur des Ich geht über in eine individuelle. Die Selbstverständlichkeit, mit der das erste Ich-Erlebnis sich im weltlichen Zusammenhang artikuliert, wird – nach innen genommen – zur Frage, was es mit dem durch das eigene Ich bewirkten Unterschiedensein auf sich hat. Das Verwobensein des eigenen Ich mit der Welt, welches für das erste Ich-Erleben noch gegeben ist, weicht einer Kluft. Das eigene Ich ist anders als das Ich jedes anderen Menschen und es ist anders als der gesamte übrige Weltinhalt. Eine Verbindung besteht nicht von sich aus, sie muss geschaffen werden. Wie soll und kann das geschehen, auf welcher Grundlage?
Wie dieser Konflikt im Einzelnen Inhalt und Form annimmt, hängt, vom Standpunkt des Ich aus gesehen, mit dessen entweder mehr physischer oder mehr geistiger Orientierung zusammen und mit dessen irdischer und himmlischer Vergangenheit und Zukunft. Welche mit diesen Voraussetzungen zusammenstimmende Entsprechung kann im irdischen Milieu gefunden werden? Auf diese mit dem im neunten Lebensjahr wiederkehrenden Ich-Erleben in die eigene Seele gewendete Frage suchte der Knabe nach einer Antwort, die ihm Klarheit darüber verschaffen sollte, welchen Wert und Bestand das auf seinem Seelenschauplatz sich vollziehende Geisterleben neben dem im dreidimensionalen Raum beheimateten, an die Sinne gebundenen Erleben, habe. Bisher war dieses Erleben in dem ihn umgebenden Milieu nicht vermittelbar. Wohl bezweifelte er es nicht, doch er suchte nach einer rechtfertigenden Zustimmung aus dem Weltzusammenhang. Dieser musste, um eine Entsprechung zu ermöglichen, dem Knaben in einer seinem Geisterleben gleichenden oder ähnelnden Weise begegnen.
Dieses Sich-Gleichen war gegeben durch die Geometrie. Durch sie vermittelte sich die ersehnte Zustimmung, welche dem Erleben rein geistiger Inhalte jenen Wirklichkeitsgehalt zusprach, den der Knabe selbst nicht infrage stellte. Hätte der junge Steiner seinem Erleben misstraut, er hätte keinen Anhaltspunkt gehabt, um ein Gleiches aufzufinden, denn worin hätte dieses bestehen können? Der Anhaltspunkt für sein Suchen bestand eben in jener der Geometrie ähnelnden, rein innerlich erlebten Wirklichkeit. Dass diese in einer in menschlicher Hinsicht resonanzlosen Umwelt nicht aufgegeben ward, deutet abermals auf die Wirksamkeit eines Willens in der Individualität Steiners, der sich vom Allgemeinen abhob. Seine individuellen Wurzeln suchten Festigkeit und Halt in einem anderen Grund als dem, den das kollektive Bewusstsein eines zeit- und ortsgebundenen Milieus ermöglichte. Die Bestimmtheit, mit der diese Suche als existenzielle Triebkraft in der Seele des Knaben wirksam war, konnte nicht Vorlieb nehmen mit dem, was der Zeitgeist zum Erleben einer geistigen Wirklichkeit hätte sagen können.
Für Steiner ging es also gar nicht darum, sich gesprächsweise bei seinen Mitmenschen zu erkundigen, ob den Gegenständen einer geistigen Wahrnehmung ein vergleichbarer Wirklichkeitsstatus zuerkannt werden könne, wie den Gegenständen sinnlicher Wahrnehmung. Dass bei den Menschen, die er kannte, eine geistige Form des Erlebens nicht gegeben war, blieb ihm schließlich nicht verborgen. Warum also hätte er sie um ein Urteil bitten sollen! Die Gestimmtheit, mit der die Suche nach einer Entsprechung zur Wirklichkeit seines inneren Erlebens sich vollzog, war also gekennzeichnet durch die offene Aufmerksamkeit auf etwas, was aus seiner eigenen Natur heraus mit seinem geistigen Erleben zusammenstimmte.
Man übergeht leicht die begrifflich schwer einzugrenzende Kraft, mit welcher die suchende Seele eines schließlich erst Neunjährigen hier voranschreitet, weil man als Leser nicht nur der Autobiografie, sondern auch vieler anderer Werke Steiners bereits die gedanklich ausformulierten Inhalte der frühen Erkenntnisbemühungen vor sich hat. Insofern der formulierte Gedanke aber immer den Endpunkt vom Lebensweg eines Geistigen markiert, wäre, um an ein Verständnis für das Seelenleben des Knaben sich annähern zu können, der rückwärtige Gang durch dieses Leben anzutreten. Er führte hinein in ein begrifflich noch ungeschiedenes und unerschlossenes Werden, das als innerer Prozess in seiner Natur sowohl als Seele als auch als Geist ungleich schwerer zu fassen ist, als es ein im Nachgang formulierter Gedanke annehmen lässt.
Tritt der Geist im Denken als Gedankenform auf, so im Willen als Ursprüngliches – als sein Leben. Im Denken kann dieses Leben also nur durch den Willen wiedererlangt werden. Genau dies aber zeigt sich uns, wenn wir genauer betrachten, wie der neunjährige Steiner sein Geisterleben zu bedenken versucht, denn der Geist wird von ihm als ein mit seiner wollenden Seele sich Einendes wahrgenommen. Daher das inständige, im Willen wurzelnde Bedürfnis, sich seinem Geisterleben nicht nur passiv zu überlassen, sondern es in seinem Wesen zu verstehen. Daher auch das Bedürfnis, geistiges Erleben als ein Phänomen des eigenen Seelenlebens von diesem in ähnlicher Weise abzuheben, wie die durch Sinneswahrnehmung sich zeigenden Dinge von den leiblichen Bedingungen des Wahrnehmens.
Diese feine Unterscheidung kennzeichnet jenen Moment, in welchem seelische Eigentätigkeit eins wird mit dem durch diese Eigentätigkeit erzeugten Inhalt. Bis in seine Substanz gibt Eigenwille im geistigen Wahrnehmen sich hin an das andere der durch ihn ermöglichten Wahrnehmung. Diese Differenzierung in das Eigene, durch dessen selbstlose Tätigkeit es sich in das Andere umwandelt aber ist es, die auch am Erleben der Geometrie aufgefunden werden kann. Es ist zudem eine erste Entdeckung des Denkens als jenem Vermögen, so im Geistigen sich zu bewegen, dass das Erlebte den ihm angemessenen Weg zum Begriff finden kann.
Geometrie, Messen und Denken
In der Geometrie wird das Messen auf die Erde als der Gesamtheit aller Erscheinungen und Vorgänge des dreidimensionalen Raumes angewendet. Durch das Messen werden die äußeren Erscheinungen nicht notgedrungen verändert. Was sich verändert, ist das Verhältnis des Menschen zu ihnen. Mit den durch die Tätigkeit des Messens ermittelten Ergebnissen tritt für das Bewusstsein des Menschen ein Inhalt auf, der – obgleich er durch eine an der Außenwelt vorgenommene Tätigkeit sich ergibt – dort als ein den Dingen zukommendes Äußeres gar nicht zu finden ist. Das durch Messen im Raum Gefundene ist gerade dadurch charakterisiert, dass von ihm alles Äußere subtrahiert wird. Was als Inhalt bleibt, ist den leiblichen Sinnen nicht zugänglich, weil, was durch leibliche Sinne wahrgenommen werden kann, nicht zu Inhalten gelangen kann, wie sie das Messen ermöglicht. Das scheint problematisch, weil der Zusammenhang, der zunächst durch das Messen mit den äußeren Erscheinungen hergestellt wird, sich zugleich als Spaltung zeigt. Wie kann in der Außenwelt eine Tätigkeit vorgenommen werden, die zu einem Inhalt führt, beispielsweise der linearen Beziehung zwischen drei Punkten, der dort nicht vorhanden ist? Der Knabe beantwortete diese Frage für sich damals in Form einer Unterscheidung:
Bei der Geometrie sagte ich mir, hier darf man etwas wissen, was nur die Seele selbst durch ihre eigene Kraft erlebt; in diesem Gefühle fand ich die Rechtfertigung, von der geistigen Welt, die ich erlebte, ebenso zu sprechen wie von der sinnlichen. Und ich sprach so davon. Ich hatte zwei Vorstellungen, die zwar unbestimmt waren, die aber schon vor meinem achten Lebensjahr in meinem Seelenleben eine große Rolle spielten. Ich unterschied Dinge und Wesenheiten, »die man sieht« und solche, »die man nicht sieht«.[4]
Wie die unterschiedenen Bereiche zusammenhängen und zueinanderfinden, wird als Problem noch nicht thematisiert. Vor allem kam es auf die durch die Geometrie an die Wahrnehmung geistiger Dinge und Wesenheiten übergehende Gewissheit an.
Geometrische Figuren, die auch mathematisch dargestellt werden können und der Zeichnung nicht notwendig bedürfen, sind nicht Gegenstände sinnlicher Erfahrung. Selbst eine noch so genau gezeichnete geometrische Figur ist nur sinnliches Bild eines allein geistig zu Verstehenden. Erst wenn man beginnt, den durch eine Zeichnung vermittelten Begriff auf die Zeichnung als Bewegung anzuwenden, vollzieht sich an ihr eine Wirkung jener geistigen Lebendigkeit, die einer geometrischen Figur als die Unendlichkeit ihrer möglichen Einzelfälle innewohnt. Die einzelne geometrische Figur ist also jeweils der Endpunkt des Lebens ihres Begriffs. Der Begriff wiederum erschließt sich nur dem Denken als einem – so die Erfahrungsweise des jungen Steiner – von allem Sinnlichen befreiten Wahrnehmen. Einem Wahrnehmen also, von dem, für das herrschende Wissenschaftsverständnis jener Zeit, nicht sinnvoll gesprochen werden konnte, da ohne ein entsprechendes Sinnesorgan auch kein Wahrnehmungsinhalt angenommen werden konnte. Beziehungsweise weil man, bei der für allgemeine Aussagen untauglichen singulären Beschaffenheit von Sinneswahrnehmungen, deren in unterschiedliche Sinnesfelder sich gliedernde Vielheit nicht auf den Zugang durch Gedanken und Begriffe übertragen konnte, den das Denken bahnt. Diese in die Erkenntnistheorie und Sinnesphysiologie reichende Fragestellung war zwar im Geometrieerlebnis des jungen Knaben biografisch bereits vorgebildet, aber noch nicht thematisiert. Nicht um die Tätigkeit des Denkens als Wahrnehmungsorgan für Gedanken, Begriffe und Ideen in den Sinneswahrnehmungen ging es, sondern um die Tätigkeit des Denkens als rechtfertigendem Vollzug geistigen Erlebens.
Was aber zeichnet ein durch Geometrie aufleuchtendes Erleben des Denkens aus? Steiner schildert, wie er durch die Geometrie eine Möglichkeit kennenlernte, in Denkhandlungen zu leben: »Als ein Wissen, das scheinbar von dem Menschen selbst erzeugt wird, das aber trotzdem eine von ihm ganz unabhängige Bedeutung hat, erschien mir die Geometrie.«[5] Der Doppelcharakter, den das Denken im Verhältnis zu seinen Gegenständen einnimmt, tritt dann rein hervor, wenn diese Gegenstände keinen Anteil an sinnlicher Wahrnehmung haben. Ihre Existenz für das denkende Bewusstsein hängt vollkommen von der diese ermöglichenden Tätigkeit ab, und trotz dieser Abhängigkeit bestehen die durch das Denken hervorgebrachten Gegenstände für sich. Hier zeigt sich erneut ein bereits angedeuteter Wesenszug des Denkens: Hervorbringen und Wahrnehmen sind in ihm eins. Im Denkakt verwandelt sich die denkende Tätigkeit permanent in ihre Gegenstände. Das Bewusstsein hat es also mit Ergebnissen der Denktätigkeit zu tun, deren für sich bestehende Bedeutung gleichwohl nur denkend hervorgebracht, bestimmt und bestätigt werden kann. Schelling hat für diese Doppelheit das Wort der »Identität des vom Wollen Unabhängigen mit dem Wollen selbst«[6] geprägt.
Denken denken
Für das Erleben des Denkens ist nun zunächst charakteristisch, dass für das Bewusstsein der Gehalt des Gedachten im Vordergrund steht, nicht die Tätigkeit, welche den Gehalt hervorbringt. Vor eine Einsicht in die ihren Gegenstand hervorbringende Denktätigkeit schiebt sich die vage Meinung, dass der intellektuelle Anteil sinnlicher Wahrnehmungen – Vorstellung, Gedanke, Begriff, Idee – lediglich als Epiphänomen der Sinneswahrnehmung, als deren intellektuelles Echo in Betracht komme. Sofern man sich klar darüber wird, dass jeder intellektuelle Prozess das Ergebnis einer Tätigkeit ist, tritt für das Denken bereits eine besondere Situation auf. Das Subjekt des Denkens macht nicht nur den gedachten Inhalt, sondern die diesen Inhalt bewirkende Tätigkeit selbst zum Gegenstand seiner Aufmerksamkeit. Was aber erlebt es dann? Wie wird das Erleben der denkenden Tätigkeit zum gedachten Gehalt? Oder ist die Frage noch nicht richtig gestellt? Geht nicht im Denken des Denkens als Gehalt die eigene Bewusstseinsform dieses Erlebens wieder verloren, weil, sobald es um einen Gehalt geht, dieser – wie schon gesagt – für das Bewusstsein im Vordergrund steht und als Gehalt immer nur das zur Ruhe gekommene Ergebnis des Denkens ist, also nichts weniger als Tätigkeit? Wie also, so könnte man die Frage modifizieren, ließe sich ein angemessenes Bewusstsein von nicht irgendeiner, sondern der denkenden Tätigkeit und nicht des gedachten Gehaltes herstellen? Denn es scheint ja für das Denken einen wichtigen qualitativen Unterschied auszumachen, ob es einen Gehalt oder sich selbst denkt. Worin besteht dieser Unterschied?
Indem das Denken sich anstrengt, auf seinen Gehalt Verzicht zu leisten, entlässt es sich selbst in die Leere. Es ist nichts da, dem es sich zuwenden könnte. Seine gewohnte Arbeit, Gehalte zu denken, setzt aus. Für ein Bewusstsein, welches die Aufgaben des Denkens mit dem Denken von Gehalten für erschöpft hält, stellt dieser Verzicht das Denken selbst infrage. Die Wachheit, die das Denken als Schöpfer eines Gehaltes noch hielt und führte, geht über in den Dämmer einer hilflosen, sich selbst fragwürdig gewordenen Untätigkeit, in der auch das denkende Ich sich verliert. Es scheint, als komme das Subjekt des Denkens nur durch inhaltliches Denken zu sich selbst. In der Tat begleitet ein diskretes Bewusstsein von der eigenen Denktätigkeit alles Gedachte. Sofern gedacht wird, besteht Klarheit, dass das Subjekt des Denkens diese Tätigkeit sich selbst zuschreibt. Was eben noch fragwürdig schien, ein Bewusstsein der Denktätigkeit, scheint also doch möglich – als begleitendes Bewusstsein, und der Inhalt dieses begleitenden Bewusstseins bestünde in dem »Ich denke». Das Denken realisiert sich also in zweifacher Hinsicht: als sich im Gehalt objektivierende Tä tigkeit und als in der Tätigkeit sich wahrnehmendes Subjekt. Es steht im Spannungsfeld von Leben und Erleben, zwischen Tätigkeit und Bewusstsein.
Stefan Weishaupt, geb. 1959 in Essen. Besuch der Rudolf Steiner Schule Ruhrgebiet in Bochum. Studierte Germanistik, Philosophie, Biologie und Pädagogik in Marburg und Sprachgestaltung und Schauspiel in Dornach. Arbeitete als Theaterpädagoge und Kulturmanager in Kassel, als Schauspieler, Regisseur und Produzent in Basel und Berlin und als Klassenlehrer und Theaterpädagoge in Lensahn. Lebensmittelpunkt in Berlin. – Kontakt: st-weishaupt@t- online.de
[1] Rudolf Steiner: ›Mein Lebensgang‹ (GA 28), Dornach 2000, S. 24f.
[2] Vgl. Stefan Weishaupt: ›Einsame Fragen‹, in: die Drei 4/2025, S. 79ff.
[3] Aristoteles: ›Nikomachische Ethik‹ 1102a, zitiert nach: ›Handbuch philosophischer Grundbegriffe Bd. 3‹, hrsg. von Hermann Krings, Hans Michael Baumgartner und Christoph Wild, München 1973, S. 607.
[4] GA 28, S. 26. Hervorhebung im Original.
[5] GA 28, S. 25.
[6] gl. F.W.J. Schelling: ›System des transzendentalen Idealismus‹, in: ›Schellings Werke 2. Hauptband: Schriften zur Naturphilosophie (1799-1801)‹, hrsg. von Manfred Schröter, München 1978, S. 575.