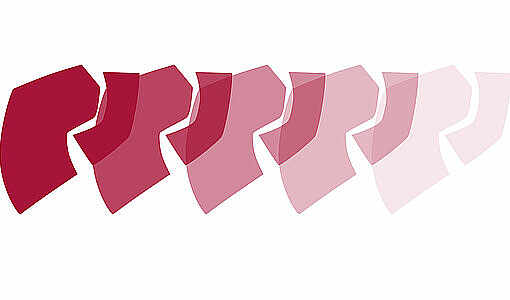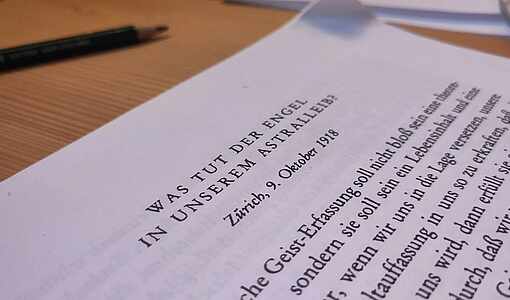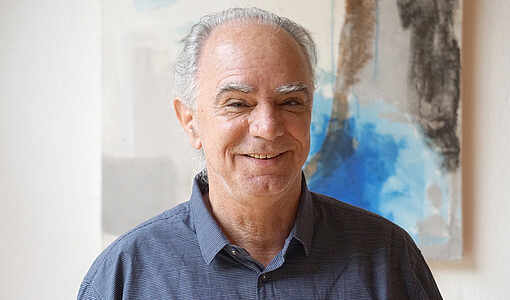Darf man vielleicht doch lügen? Zum Problem der Notlüge
Theodor Storm (1817–1888) wurde nicht ganz 71 Jahre alt. Noch in seinem Sterbejahr vollendete er «Der Schimmelreiter» – jene großartige Novelle über einen Deichgrafen, der mit seinen Innovationen im Konflikt zwischen Wissenschaft und Aberglaube zugrunde geht.
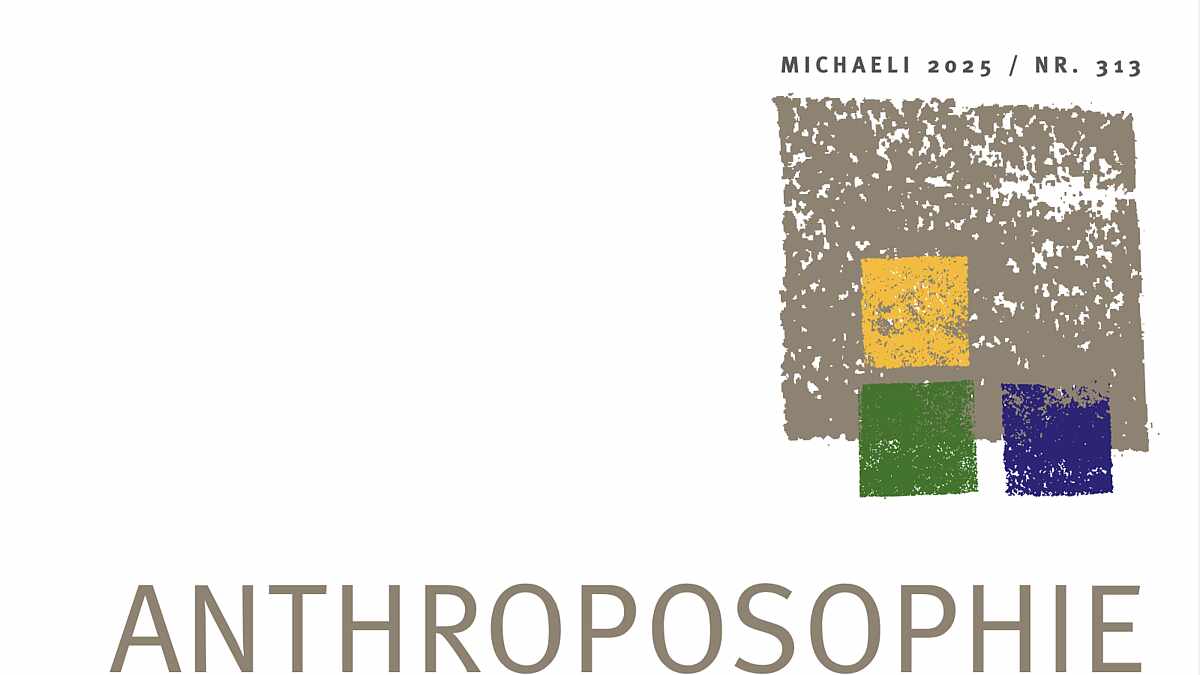
Theodor Storm (1817–1888) wurde nicht ganz 71 Jahre alt. Noch in seinem Sterbejahr vollendete er «Der Schimmelreiter» – jene großartige Novelle über einen Deichgrafen, der mit seinen Innovationen im Konflikt zwischen Wissenschaft und Aberglaube zugrunde geht. Die letzten anderthalb Jahre seines Lebens litt Storm an Magenbeschwerden, die ihn stark beeinträchtigten. Er wollte wissen, was er hatte, und forderte von seinem Hausarzt Klarheit über seinen Zustand. Dieser sagte ihm schließlich, dass es Magenkrebs sei – eine damals als unheilbar geltende Krankheit. «Aber Storm», so schreibt seine Tochter Gertrud später in der Biographie ihres Vaters, «hatte sich überschätzt; er vermochte die Gewissheit eines nahen Todes nicht zu ertragen. Tiefe Schwermut ergriff ihn.» [1]
Die Menschen um ihn sahen, wie er nun nicht nur unter der physischen Krankheit, sondern auch seelisch unter der Diagnose und der Hoffnungslosigkeit litt. Er würde «Der Schimmelreiter» nicht zu Ende schreiben können. Um ihn aus seiner Depression zu befreien, veranstalteten sein Bruder, der Arzt Aemil Storm, und ein weiterer Arzt eine weitere Untersuchung und ein – wie Thomas Mann in seinem Essay über Theodor Storm [2] es nennt – «Humbug-Konsilium», in dem sie sich mit dem Hausarzt darüber verständigten, dass der Dichter eine Herz-Kreislauf-Erkrankung und eine Erweiterung der Aorta habe – also nichts direkt Lebensbedrohliches. Das war die Lösung. Sie schenkte Storm einen «heiteren Sommer», so die Tochter, und sie gab ihm die Kraft, sein Meisterwerk zu vollenden, das im April 1888 erschien. Am 4. Juli starb der Dichter an den Folgen seiner Krankheit.
Ohne die Scheinuntersuchung und die, wie Thomas Mann meint, «barmherzige Illusionierung» und die Fähigkeit, sich solchermaßen belügen zu lassen, hätten wir die Novelle «Der Schimmelreiter» heute nicht, und Storm hätte sich vermutlich nur noch durch seine letzten Lebensmonate gequält.
«Pia fraus», «frommen Betrug», nennt man eine solche Lüge, die man erzählt, um etwas Gutes zu erreichen. Sie ist gewiss keine Seltenheit. Auch Thomas Mann wurde fromm belogen, als er am Ende seines Lebens (1955) eine gefährliche Thrombose hatte. Eine Venenentzündung sei es, und er hat das gern so angenommen. Jahre zuvor schon (1946) hatte man seine Lungenkrebserkrankung in einen Lungen-Abszess umgelogen, was ihm half, die Wirklichkeit zu verdrängen und vielleicht auch die Genesung nach der Operation zu befördern.
Wollen wir den Lügnern in diesen und ähnlichen Fällen ihre Not- und Zwecklügen verübeln? Ich würde nicht gern auf jenes große Stück Weltliteratur verzichten, das wir ihnen verdanken, und gönne Storm herzlich die Erleichterung, die die Lüge ihm in seinen letzten Monaten brachte. Aber ganz einfach ist die Sache nicht.
Es gibt einige große Autoren der Philosophie- und Theologiegeschichte, die mit starken Gründen das Lügen – egal in welcher Lebenslage – absolut ablehnen.
So finden wir eine Totalverwerfung der Lüge prominent bei Aurelius Augustin, Thomas von Aquin, Immanuel Kant und Rudolf Steiner. Die genannten Denker stehen dabei in Bezug zu einem Metaphysikum, das heißt, sie schauen nicht auf die innerweltlichen Konsequenzen der Lüge, sondern auf Gott und das ewige Leben (Augustin, Thomas), die Menschheit im Allgemeinen und die Würde des Einzelnen (Kant) oder auf die geistige Welt, in der die Wesen und Gedankenformen, die der Lüge dort entsprechen, zerstörerisch wirken (Rudolf Steiner).
Augustinus
Augustin (gest. 430 n. Chr.) ist der erste, der die Lüge definiert hat: Sie ist «eine Äußerung mit der Absicht zu täuschen». Es «lügt derjenige, der etwas anderes, als was er im Herzen trägt, durch Worte oder sonstige Zeichen, zum Ausdruck bringt»[3]. Die Lüge widerspricht der natürlichen Aufgabe der von Gott gegebenen Sprache, die Wahrheit mitzuteilen. Sie stört die Ordnung der Welt, denn sie setzt, um erfolgreich sein zu können, voraus, dass man der Lüge vertraut wie der Wahrheit, und zerstört zugleich dieses Vertrauen bei ihrer Entdeckung. Jede Lüge bedeutet eine Entzweiung mit sich selbst, denn der Lügner weiß ja, was wahr ist, sagt aber etwas anderes. Hinter dem ausgesprochenen Lügensatz steht ein unausgesprochener Wahrheitssatz. Diese Selbstentzweiung ist für Augustin eine Abwendung von Gott und deshalb eine Sünde. Die Sünde aber bedeutet den Verlust des ewigen Lebens, hat also fatale Folgen nicht nur für den Belogenen, sondern auch für den Lügner selbst. «Da man also durch Lügen das ewige Leben verliert, darf man niemals um des zeitlichen Lebens einer Person willen lügen.» Man hätte also Theodor Storm die Wahrheit sagen müssen oder aber – das ist die einzige Alternative, die Augustin zugesteht – man hätte schweigen müssen.
Thomas von Aquin
Auch für Thomas von Aquin hat jede Lüge (auch die Notlüge) sündhaften Charakter, weil sie aus der Übereinstimmung mit Gott ausbricht. Alle Wahrheit stammt von Gott. Die Dinge sind wahr, weil sie von Gott geschaffen wurden. Der menschliche Verstand ist in der Lage, die Wahrheit der Dinge zu erkennen, indem er sich ihnen anpasst, und mittels der Sprache kann er sie dann kommunizieren. Wer aber lügt, missbraucht die Sprache, beschädigt die Einheit von Erkennendem und Seiendem und stört damit die Ordnung, «die von Natur aus zwischen der erkannten Sache und dem Zeichen, das die Rede ist, bestehen sollte»[4] Die Wahrheit ist, weil sie göttlich ist, ein absoluter Wert, der durch nichts relativiert werden darf.
Immanuel Kant
Immanuel Kant nun begründet sein absolutes Lügenverbot nicht mit Gott oder der Göttlichkeit der Wahrheit, sondern mit «der Menschheit überhaupt». Wahrhaftigkeit ist eine Pflicht, deren Erfüllung die Grundlage für alles Zusammenleben bildet. Würde man die Lüge auch nur ausnahmsweise legitimieren, wie etwa die medizinische Lüge gegenüber Storm, so würde man das Vertrauen zwischen den Menschen und die Möglichkeit verbindlicher Verträge und Versprechen untergraben.[5] Man würde den kategorischen Imperativ außer Kraft setzen, nach dem jede Handlung einem Prinzip folgen muss, das widerspruchsfrei zu einem allgemeinen Gesetz erhoben werden kann. Die kürzeste Form dieses Imperativs lautet als sogenannte «Universalisierungsformel» wie folgt: «Handle nach der Maxime, die sich selbst zugleich zum allgemeinen Gesetze machen kann.»[6] Das heißt, bei allem, was ich tue, muss ich wollen können, dass jeder andere in dieser Situation genauso handeln würde.
Auch die Würde eines jeden Menschen sieht Kant durch die Lüge bedroht, denn durch sie wird der Belogene als ein Mittel zum Zweck missbraucht, d. h. er wird Werkzeug dafür, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Damit ist er kein reiner «Selbstzweck» mehr, der in seiner Autonomie und Freiheit respektiert wird.[7] Denn das macht die Würde des Menschen aus, dass er jederzeit in der Lage ist, sein Leben selbst zu gestalten, sich selbst zu bestimmen. Wer ihn belügt, übt eine Gewalt auf ihn aus, so dass der Belogene sich nicht mehr nach der Sachlage richten kann, sondern dem Willen des Lügners unterliegt. Selbst wenn die Absicht gut ist, ist die Lüge für Kant moralisch unzulässig. Auf das Storm-Beispiel bezogen könnte das bedeuten, dass man den Dichter mit der «barmherzigen Illusionierung» dazu instrumentalisiert habe, seine Novelle «Der Schimmelreiter» zu Ende zu schreiben. Aber war das nicht auch in seinem Sinne? Und wenn der Zweck der Lüge vor allem in der Erleichterung gelegen hat, die man ihm mit der wohltätig geänderten, aber falschen Diagnose verschaffte, hat man ihn damit nicht auch zu sich selbst befreit? Kant ist rigoros. Er geht bis zum Äußersten, so wenn er etwa in dem Fall, dass ein potenzieller Mörder vor unserer Tür steht und uns nach unserem Freund fragt, den er verfolgt und der bei uns Schutz gefunden hat, es für moralisch verboten hält, den Mörder zu belügen. Allenfalls schweigen kann man, aber nicht sagen, dass der Gesuchte nicht bei uns sei. Für Kant steht das Verbot der Lüge höher als das der Hilfe gegenüber dem Verfolgten, denn auch hier würde die Lüge die Verlässlichkeit von Aussagen grundsätzlich demontieren. Wird hier nicht aber das Prinzipielle in äußerst bedenklicher Weise verabsolutiert? Das Gefühl jedenfalls sträubt sich – und wohl auch die Urteilskraft, die auch auf die Ausnahme sieht, den Sonderfall, der sich eben nie verallgemeinern lässt.
Kants Rigorismus beruht zum einen darauf, dass der kategorische Imperativ absolut allgemeingültig sein soll, und zum anderen, dass er nicht die Folgen des Handelns für die unmittelbar Betroffenen berücksichtigt, zu denen es durch die Wahrheit oder die Lüge kommt. Diese Folgen zu berücksichtigen – das würde in eine andere Ausrichtung der Ethik gehören, nämlich in die des sogenannten Konsequenzialismus. In dieselbe Richtung wie dieser geht auch der Utilitarismus, der auf das größtmögliche Glück einer größtmöglichen Zahl von Menschen ausgerichtet ist – mit welchen Mitteln auch immer. Kants Ethik hingegen ist eine deontologische bzw. Pflichtethik (griech. δέον [déon] = das Erforderliche, Gesollte, die Pflicht), d. h. der moralische Wert der Handlung liegt in ihr selbst und nicht in den Konsequenzen oder dem Nutzen. Die Ärzte im Umfeld Theodor Storms haben also konsequentialistisch bzw. utilitaristisch gehandelt und nicht im Sinne Kants.
Auch die Ethik eines Augustin oder Thomas ist wie die Kants kategorisch und deontologisch, d. h. sie ist an einem Absoluten ausgerichtet – an Gott, der Wahrheit, der reinen Vernunft, der Menschenwürde – und damit unabhängig von den Besonderheiten der jeweiligen Situation und den möglichen Konsequenzen.
Allenfalls der durch eine Lüge drohende Verlust des ewigen Lebens gehört in eine Art konsequentialistisches Konzept, denn hier hätte die Aufkündigung mit dem vor Gott allein Angemessenen fatale Folgen für einen selbst.
Rudolf Steiner
Von Rudolf Steiners Freiheitsphilosophie kennen wir eine große Skepsis, ja Ablehnung gegenüber der Pflichtethik des kategorischen Imperativs. Für ihn schließt das Handeln nach einem allgemeinen Prinzip und aus bloßer Pflicht die Freiheit aus. Steiners Denken ist vielmehr getragen von dem Vertrauen in eine Sittlichkeitsmaxime, die intuitiv im Menschen lebt und die verbunden ist mit der Liebe zu dem, was er verwirklichen will. Der Mensch hat die Fähigkeit, in jeder Situation neu und schöpferisch eine ethische Handlung hervorzubringen, die dieser angemessen ist.
Seine «moralische Fantasie» braucht keine äußeren Regeln und Gebote, sondern erzeugt in sich ein handlungsleitendes Bild für jede einzelne Situation. Nur wenn er diesem gemäß handelt, handelt er frei und eigenverantwortlich. Die Richtlinie des «ethischen Individualismus» ist die Liebe, die Steiner recht selbstverständlich voraussetzt,[8] was Kant nie getan hätte.
Was das Storm-Beispiel betrifft, könnte man meinen, dass es sehr wohl die Liebe zu dem Dichter gewesen sein kann, die die Ärzte in seinem Umfeld zu ihrer wohltätigen Falschdiagnose bewog. Was spricht dagegen, dass die pia fraus gegenüber Storm der moralischen Fantasie entsprang? Bei einem anderen Menschen mit einer ähnlich tödlichen Krankheit wäre sie vielleicht nicht «nötig» gewesen. Einen anderen hätte das Wissen um seinen nahen Tod vielleicht dazu veranlasst, jetzt nur noch das für ihn Allerwichtigste zu tun, was er sonst aufgeschoben hätte.[9] Je nach betroffener Persönlichkeit könnte also die moralische Entscheidung ganz verschieden ausfallen. Fragen wir nun aber konkret nach der Lüge bei Rudolf Steiner, so bekommen wir eine Antwort, die nicht auf den jeweiligen Einzelfall bezogen ist, sondern prinzipiell gilt. Steiner verurteilt die Lüge nämlich ebenso grundsätzlich wie Augustin, Thomas und Kant. Sein Argument allerdings bezieht sich dabei auf die Folgen der Lüge, nämlich auf ihre zerstörerische, ja tödliche Kraft. Zwar muss ein Gedanke, ein Satz, der wahr ist oder erlogen, in der irdischen Welt nicht unbedingt physische Konsequenzen haben, aber in der geistigen Welt – auf dem «Astralplan» – entsprechen ihm Wesenheiten, Formen, Astralgebilde, die mit denen zusammenstoßen, die den Tatsachen entsprechen. Da ist es ein absoluter Unterschied, ob man nun den Tatsachen gemäß denkt und spricht oder nicht: «Wenn nun Ihre Gedankenform der anderen [die von der Sache selbst ausgeht, R. E.] entspricht, wenn sie mit ihr übereinstimmt, dann strömen die beiden Formen auf dem Astralplan zusammen und verstärken sich. Damit haben Sie das Leben dieser Wesenheit verstärkt. Aber bei einer Unwahrheit stimmt die Gedankenform, die von Ihrer Aussage ausströmt, nicht überein mit derjenigen, die von der Sache selbst ausgeht. Die Formen platzen aufeinander und zerstören sich. So wirkt die Unwahrheit, die Lüge, lebenzerstörend und tötend auf andere.»[10]
Steiner spricht wiederholt sogar davon, dass die Lüge ein Mord auf dem Astralplan sei. Und sie ist nicht nur Mord, sondern mit ihr «tötet» sich der Lügner auch selbst: «Die Lüge ist vom astralen Standpunkt ein Mord und ein Selbstmord zugleich. Sie spiegelt dem anderen etwas vor und erzeugt in ihm ein Gefühl, das sich auf eine nicht vorhandene Tatsache bezieht, auf ein Nichts. Auf dem Astralplan tritt sofort das Gegenbild auf von dem Nichts, das Töten. Sie ertöten also etwas im Menschen, wenn Sie durch Lüge sein Gefühl lenken auf etwas, was nicht ist, und Sie begehen Selbstmord […]»[11]
Die Wirkung der Lüge ist so gravierend, dass Steiner das von sich aus einleuchtend starke Gebot «Du sollst nicht töten» für den Astralplan in ein «Lüge nicht» übersetzt.[12] Lügen ist genauso schlimm wie töten.
Rudolf Steiner ist in Sachen Lüge nicht weniger prinzipiell als die genannten anderen Philosophen, aber er spricht nicht deontologisch, sondern konsequentialistisch, d. h. es geht nicht um eine allgemeine Pflicht zur Wahrheit um Gottes oder der Menschheit willen (er argumentiert mit den konkreten individuellen Folgen, die eine Lüge zwar nicht unmittelbar hat – unmittelbar kann sie in der physischen Welt vielleicht sogar Gutes bewirken), sondern um die Konsequenzen der Lüge auf geistiger Ebene. Von hier aus werden sich die Folgen von Wahrheit und Lüge auch wieder bei dem bemerkbar machen, von dem die Lüge ausging. Sie gehören mit zu seiner Entwicklung: «Die der Wahrheit entsprechende Erzählung bildet die Lebenskräfte für die Fortentwickelung. Die unrichtige Behauptung schlägt an die Wahrheit und schlägt zurück auf den Menschen selbst. Alles, was der Mensch lügt, hat er später selber zu fühlen.»[13]
Die Lüge hat natürlich auch ihre karmischen Folgen. Sie ist eine Handlung, die karmisch bis hinein ins Körperliche wirken kann. Freilich gilt das v. a. für eine besonders ausgeprägte Disposition zur Lügenhaftigkeit, die aus tieferen Schichten der Seele hervorgeht, wie unbewusst geschieht und selbst wiederum ihre karmischen Ursachen hat. So führe ein «flatterhaftes Leben, das keine Hingabe und keine Liebe kennt […] zur Lügenhaftigkeit in der nächsten Verkörperung» und diese wiederum führte zu «unrichtig gebauten Organen» in der darauffolgenden Inkarnation.[14]
Was nun die Notlüge, im Sinne der pia fraus, wie sie Theodor Storm erzählt wurde, betrifft, so äußert sich Rudolf Steiner auch hier entschieden ablehnend, freilich ohne Bezug auf Beispiele.
In seinem Vortrag «Die Liebe und ihre Bedeutung in der Welt» erklärt er am Ende: «[…] wer in Liebe aufgeht innerhalb der Tatsachen, der kennt keine Lüge. Die Lüge entstammt dem Egoismus, ausnahmslos.»[15] Einen Hauch weicher, aber ebenfalls entschieden, ist die Antwort, die er auf eine nicht dokumentierte Publikumsfrage zu diesem Vortrag gibt: «Ein Verschweigen aus Liebe, eine Notlüge, ist immer eine sehr komplizierte Tat. Eine Notlüge aus Liebe kann eine Notwendigkeit sein, zunächst scheint sie ja unter Umständen eine gute Tat, aber auf sehr komplizierte Weise verbindet sie. Durch die Notlüge haben wir uns karmisch verbunden mit dem Betreffenden, und zwar mit seiner Schwäche haben wir uns verbunden. Wir werden später wieder etwas mit ihm zu tun haben. Wir werden ihm später die Wahrheit zu sagen haben. Wir werden später durch eine recht unsympathische Wahrheit, die wir ihm zu sagen haben, dies als einen Entwicklungsfaktor auszugleichen haben.
Es ist gut, dass das so ist, denn wenn wir gezwungen sind zu einer Notlüge, so ist das schon karmisch, egoistisch also, denn eine Notlüge auch als Notlüge [sic] ist eine egoistische Tat, sie hat nichts zu tun mit einer wahren Liebestat. Denn ein Stückchen Klugheit gehört schon immer zur Notlüge. Sie geschieht nicht nur aus Liebesentscheidung.»[16]
Diese Antwort hat einen Verlauf – vermutlich veranlagt durch die Frage. So ist am Anfang noch von einer «Notlüge aus Liebe» die Rede, am Ende aber heißt es, dass sie eine egoistische Tat sei und nichts zu tun habe mir einer wahren Liebestat. Dass es kompliziert ist, gesteht auch Steiner zu. Auf jeden Fall schafft die Notlüge eine karmische Verbindung zwischen Lügner und Belogenem. Dass sich die Ärzte um Theodor Storm durch ihre den Dichter schonende Notlügen-Diagnose mit ihm und seiner Schwäche verbunden haben, leuchtet ein. Damit ist betont, dass es nicht gleichgültig ist, was wir tun, dass wir in jedem Fall die Konsequenzen zu tragen haben werden. Die Zuversicht, die uns der eingegangene karmische Zusammenhang geben kann, besteht darin, dass sich in der Wirkung auf jeden Fall Wahrheit ereignen wird. Das heißt: Die Lüge hat nicht das letzte Wort. Das Karma sorgt für Wahrheit. In welcher Form man dann dem Belogenen in einem künftigen Leben die Wahrheit zu sagen oder welchen Preis man sonst zu zahlen haben wird, das müssen wir aber der «karmischen Fantasie» der Beziehung überlassen.
Aber könnte es nicht doch sein, dass man aus «moralischer Fantasie» in der jeweiligen Situation ohne den Blick auf mögliche karmische Konsequenzen handelt? Wäre nicht auch die spekulative Berücksichtigung solcher Folgen eine Strategie, ein Kalkül, das nicht weniger egoistisch ist als die Notlüge? So jedenfalls kann man das in dem folgenden Beispiel erleben: Eine junge Frau in einer schwierigen Lebenssituation ist ungewollt schwanger geworden. Sie fragt ihren Frauenarzt nach den Möglichkeiten einer Abtreibung und erhält von ihm die Antwort: «Ich lasse mir doch von Ihnen mein Karma nicht verderben.» Natürlich hätte der Arzt der jungen Frau unbedingt nahebringen sollen, das Kind zu behalten, und außerdem handelt es sich hier nicht um eine Lüge, aber der Blick auf die Konsequenzen ist eben nicht unegoistisch. Das gilt sicher nicht nur in karmischer Hinsicht, sondern auch für die Drohung mit dem Verlust des Seelenheils bzw. des ewigen Lebens (Augustin) bei einer Lüge.
Die Zukunft – ob als karmische Entwicklung oder nachtodliches Heil gedacht – darf oder soll sehr wohl eine Rolle spielen und wird das tun, aber auch hier geht es um Wahrhaftigkeit. Und diese hat mit der Bereitschaft zu tun, sich ganz auf die jeweilige Situation einzulassen. Dazu gehört auch die Bereitschaft, gemeinsam mit dem Betroffenen in die Zukunft zu gehen, die Verbindung, die man mit ihm eingegangen ist, tatsächlich auch weiterzutragen.
Ist es nicht auch denkbar, dass man in Abwägung aller Faktoren der Situation, sich für die Notlüge entscheidet, wenn man bereit ist, die Konsequenzen mitzutragen? Eine Bequemlichkeitslüge mag sich grundsätzlich verbieten. Aber der Fall Theodor Storms macht deutlich, dass es im Einzelfall auch noch um anderes gehen kann: um die Produktivität einer neuen Lebenszuversicht, die Storm durch die barmherzige Lüge ermöglicht wurde. Sind die, die ihn solchermaßen belogen haben, bereit, auch in Zukunft mit ihm zu gehen? – Das könnte ein Kriterium für die Entscheidung und ihre moralische Bedeutung sein: nämlich, dass man sich nicht aus der Affäre zieht.
Im Hinblick auf den Egoismus unterscheiden sich Wahrheit und Lüge nur bedingt: Die Wahrheit will die späteren Konsequenzen nicht tragen, die Lüge die unmittelbaren nicht. In der Entscheidungssituation muss sich jeder nach seiner Beziehung zu dem Betroffenen fragen. Sie ist immer kontextbezogen, konkret und individuell. In seinem fragmentarischen Aufsatz über die Frage «Was heißt die Wahrheit sagen?» schreibt Dietrich Bonhoeffer: «Das wahrheitsgemäße Wort ist nicht eine in sich konstante Größe, sondern ist so lebendig wie das Leben selbst. Wo es sich vom Leben und von der Beziehung zum konkreten anderen Menschen löst, wo die ‹Wahrheit gesagt wird› ohne Beachtung dessen, zu dem ich sie sage, dort hat sie nur den Schein, aber nicht das Wesen der Wahrheit. Es ist der Zyniker, der unter dem Anspruch überall und jederzeit und jedem Menschen in gleicher Weise ‹die Wahrheit zu sagen›, nur ein totes Götzenbild der Wahrheit zur Schau stellt.»[17]
Es bleibt die Frage, ob wir im Hinblick auf Wahrheit und Lüge so einfach schuldlos durchs Leben gehen können, indem wir immer erbarmungslos die Wahrheit sagen. Kann es nicht auch sein, dass wir in dem einen oder anderen Fall die Schuld auf uns nehmen müssen?[18]
Natürlich wäre es «besser» gewesen, man hätte Storm die Wahrheit so sagen können, dass er daraufhin gespürt hätte, dass er in der Zeit, die ihm noch bleibt, sein Meisterwerk abzuschließen versuchen muss, und man hätte ihn dabei begleiten können. Aber gibt es nicht auch das Gefühl, das sich einer Schwäche erbarmt? Und ist nicht auch eine karmische Zukunft denkbar, in der man aus der gemeinsam durchlebten Lüge ein neues produktives Schicksal gestaltet, das im Bewusstsein des gewesenen Betrugs zu einer neuen Wahrheit gelangt? – Eine Lüge lässt sich nicht rechtfertigen, aber die Schuld an ihr lässt sich übernehmen und damit neues, anderes Schicksal schaffen, das auch seinen Sinn hat.
Dr. Ruth Ewertowski, geboren 1963 in Frankfurt/M., studierte Germanistik, Philosophie und Anglistik und promovierte über das Thema des Außermoralischen. Sie ist Redakteurin der Zeitschrift «Die Christengemeinschaft» und freieAutorin. Veröffentlichungen u. a.: «Judas. Das Paradox von Schuld und Sinn», «Das Opfer. Zwischen Schicksalsschlag und heiliger Handlung», «Revolution im Ich. Einweihung als Wiedergeburt», «Das Vertrauen. Vom Verlust und Finden eines Lebensprinzips», «Das Buch der Fügungen. Schlüsselereignisse in der Bibel». Ruth Ewertowski lebt mit ihrem Mann in Stuttgart.
[1] Gertrud Storm: Theodor Storm. Ein Bild seines Lebens. Mit einem Nachwort v. Walter Zimorski, Hildesheim u. a. 1991 (Nachdruck der Ausgabe Berlin 1912), Bd. 2, S. 227.
[2] Vgl. Thomas Mann: Gesammelte Werke, Bd. 9. Frankfurt/M. 1974. Erstveröffentlichung 1930.
[3] Augustinus: De mendacio (Über die Lüge). Der Text liegt nicht in deutscher Übersetzung vor, er wurde hier von der Autorin aus dem Englischen übersetzt. In: Treatises on Various Subjects (The Fathers of the Church, Volume 16) Saint Augustine: Lying, Chapter 3, Translated by Sister Mary sarah Muldowney,Catholic University of America Press 1952.
[4] Thomas von Aquin: Summa Theologiae. De mendacio (Über die Lüge). Fragen 9 und 10.
[5] Die Lüge «schadet jederzeit einem anderen, wenn gleich nicht einem andern Menschen, doch der Menschheit überhaupt, indem sie die Rechtsquelle unbrauchbar macht». Immanuel Kant: Sämtliche Werke in chronologischer Reihenfolge Band 7. 1867, S. 308, «Über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen».
[6] Immanuell Kant: Kritik der praktischen Vernunft. «§ 7 Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft».
[7] Eine Formulierung der sog. Selbstzweckformel des kategorischen Imperativs lautet: «Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.» Immanuell Kant: Werke in 6 Bänden. Band 4. Darmstadt 1956, S. 61, «Grundlegung zur Metaphysik der Sitten».
[8] Siehe Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit. (GA 4), 9. Kapitel.
[9] Der Autor des berühmten Jugendromans «Tschick», Wolfgang Herrndorf, setzte trotz der erschütternden Diagnose Hirntumor seine Arbeit am Roman mit noch größerer Intensität und Disziplin fort. Zudem berichtete er ganz offen in einem Blog von seiner fortschreitenden Krankheit. Seine in dieser Zeit geschriebenen Texte leben von Ehrlichkeit, Humor und Selbstironie. Das Schreiben war für ihn der Weg, die verbleibende Zeit sinnvoll zu gestalten. Schließlich setzte er, vermutlich am letzten Tag, an dem er dazu noch in der Lage war, mit einem Schuss seinem Leben selbst ein Ende.
[10] Rudolf Steiner: Kosmogonie. (GA 94), Vortrag vom 29.6.1906.
[11] Rudolf Steiner: Grundelement der Esoterik. (GA 93a), Vortrag vom 17.10.1905. Vgl. auch: (GA 95), Vortrag vom 23.8.1906; (GA 96) Vortrag vom 12.6.1907; (GA 99) Vortrag vom 30.5.1907.
[12] Rudolf Steiner: Kosmogonie. (GA 94), Vortrag vom 25.5.1906.
[13] Rudolf Steiner: Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft. (GA 96), Vortrag vom 12.6.1907.
[14] «So können wir drei aufeinanderfolgende Inkarnationen in ihren Wirkungen karmisch verfolgen: Oberflächlichkeit und Flatterhaftigkeit in der ersten Inkarnation, Hang zur Lügenhaftigkeit in der zweiten und physische Krankheitsdisposition in der dritten Inkarnation.» – Rudolf Steiner: Offenbarungen des Karma. (GA 120), Vortrag vom 18.5.1910.
[15] Rudolf Steiner: Erfahrungen des Übersinnlichen[…]. (GA 143), Vortrag vom 17.12.1912.
[16] Ebd.
[17] Dietrich Bonhoeffer: Konspiration und Haft 1940–1945. Werke, Band 16.München 1996, S. 619f
[18] Einen vergleichbaren Fall finden wir z. B. in Ferdinand von Schirachs Theaterstück «Terror». Hier hat ein Kampfjetpilot eine entführte Verkehrsmaschine abgeschossen, die von ihren Entführern zum Absturz auf ein volles Fußballstadion gelenkt wurde. Der Pilot des Kampfjets hat sich damit am Tod der Passagiere des Verkehrsflugzeuges schuldig gemacht, sie als Mittel zum Zweck der Rettung der viel größeren Zahl an Stadionbesuchern geopfert. Er hatte ohne Weisung, aber aus einem nachvollziehbaren Gefühl gehandelt. In dieser schwierigen Situation konnte er es nur falsch machen. Sein eigentlicher Fehler aber liegt vielleicht in der Verteidigung seines Handelns. Er hätte die Schuld auf sich nehmen und sich damit in die Schicksalsdimension fügen können, die womöglich seinem weiteren Karma mit den getöteten Passagieren eine Wendung ins Positive hätte geben können. – Auch die Ärzte im Umfeld Storms waren – wenn auch nicht in so drastischer Weise – in einer vergleichbaren Notlage: Sie konnten es nur falsch machen, d. h. sie konnten den Dichter in die Depression stürzen oder belügen. Sie taten Letzteres und müssen dafür die Verantwortung tragen.