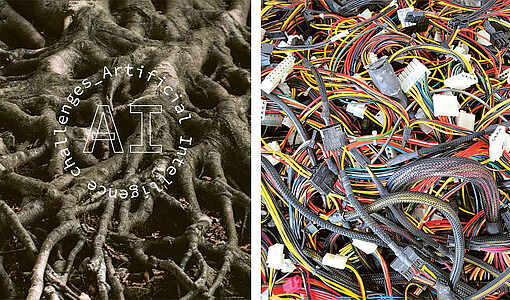Das Ich als Verb
Gedanken zur Identitätspolitik.
 Fingerabdruck | Bild: Pixabay
Fingerabdruck | Bild: Pixabay »Was sind Sie?« fragte mich einmal kopfschüttelnd ein Prüfer vom Schulamt, als er für eine provisorische Unterrichtsgenehmigung meine Lehrprobe zu beurteilen hatte und mit offenbar wachsendem Erstaunen in meinem Lebenslauf blätterte. Die Frage, »was« jemand ist oder werden will, betrifft seine äußere Stellung in der Welt, wie sich der Mensch in die Gesellschaft inkarniert und was er beruflich verkörpert, was ihn ausweist wie die identity card.
Doch wie ist es mit der seelischen Ebene? Auch dort erscheint man so oder so, und es kann zu Problemen kommen, wenn es darum geht, diese Ausprägungen sensibel einzuordnen. Die gegenwärtige Bewusstseinsveränderung auf dem Feld von Identität und Diskriminierung zeigt uns, dass gerade das Gutgemeinte nicht automatisch als etwas Gutes erlebt wird. Wenn jemand sagt: »Ich weiß genau, wie Du Dich fühlst. Ich verstehe Dich, mir geht es genauso«, kann man sich dennoch sehr allein fühlen. Zwar handelt es sich um eine anteilnehmende Ermutigung, und das Behauptete kann auch tatsächlich zutreffen. Aber manchmal ist es viel respektvoller, wenn man kein allzu rasches, selbstverständliches Mitfühlen signalisiert und bei sich selbst voraussetzt, sondern zuerst einmal innehält, nachlauscht, diskret bleibt. Und Differenz zulässt und sogar einen Abgrund für möglich hält und aushält.
Einsame Menschen fühlen sich oft durchaus weniger einsam, wenn man ihnen ihre Einsamkeit nicht ausredet, sondern sie ernst nimmt. Zumindest kann dies für geistig-seelische Einsamkeit gelten, für ein Gefühl, das man auch als Heimatlosigkeit bezeichnen könnte: das Empfinden, aufgrund bestimmter Umstände oder Dispositionen nirgendwo so richtig hinzugehören, obwohl man dies gerne würde. Wer aufgrund der Hautfarbe diskriminiert wird, erwartet daher, dass niemand, der »weiß« ist, hier ein Mitspracherecht in Anspruch nimmt oder für sich selbst felsenfest ausschließt, Teil eines strukturellen Rassismus zu sein.
Was auf der körperlichen Ebene ein Erleben von »Ich fühle mich geschlechtslos« sein kann, auf einer mehr räumlichen »Ich bin nur Gast an diesem Ort«, das kann auf noch einer anderen – sie ist schwer zu benennen – dem Folgenden entsprechen: »Ich kann mich intellektuell mit so verschiedenen Strömungen identifizieren, spirituellen oder beruflichen Konzepten, politischen Ansichten oder Weltanschauungen, mit Lebensgefühlen, Milieus, Sprechweisen und Kommunikationsformen, ästhetischen Vorlieben oder kulturellen Gewohnheiten, mit divergierenden Standpunkten in aktuellen Diskursen, dass ich nicht festzulegen bin, nicht zu ›erkennen‹, nicht zu verstehen.«
Ich wurde einmal von einem anthroposophischen Redakteur anlässlich eines bestimmten Themas sinngemäß mit der Vermutung konfrontiert, ich wisse womöglich selber nicht, wo ich stehe. Er meinte dies meiner Erinnerung nach neutral bis sanft ironisch; was ich erwiderte, weiß ich nicht mehr. Die Frage, wie jemand über etwas denkt, mag die intellektuelle Ebene berühren. Womit, fragt man dann, sollen oder können wir dich identifizieren? Was können oder sollen wir dir glauben? Weißt du überhaupt selbst, was du »findest«? Wie finden wir dich? Jener Redakteur mutmaßte, dass es (in dem betreffenden Fall, aber wohl auch grundsätzlich) einen festen Standpunkt bei Menschen meines Naturells gar nicht gebe.
Die Substanz im Entstehenden
Aus heutiger Sicht müsste ich in der Tat antworten: Ja, ich »stehe« nicht. Ich bewege mich – aber dazu stehe ich. Ich lasse mich bewegen, von dem einen wie von dem anderen. Von manchen Dingen (oder Menschen) immer wieder, von anderen seltener. Diese für meinesgleichen natürliche Gewohnheit erlebe ich gegenwärtig als angemessen und fruchtbar. In dieser Weise flexibel zu sein, in Prozessen zu denken und, wenn ich mich artikuliere, jeweils das hinzuzufügen, wovon ich meine, dass es gerade fehlt, eröffnet Handlungsspielräume. In der unmittelbaren Begegnung schafft es Raum für heilsame Überraschungen, und im Medium des Schreibens entsteht Reifung, als würde Textkörpern erst im Gespräch über sie Leben eingehaucht, als läge das Entscheidende einer Publikation jenseits des Buchs. Nicht jeder Text ist dafür geeignet: Texte müssen, so sagt man, auch »Fleisch« haben, sie müssen zum Punkt kommen oder doch erahnen lassen, wo dieser ist und wo man, wie an einem Zipfel, an der Peripherie, die »Identität« des Textes zu fassen bekommt, um mit dem eigenen Wahrnehmen und Denken daran anzuknüpfen.
Manchmal sieht eine Bewegung so aus, als würden die Worte etwas umkreisen, ein Zentrum, das aber seinerseits sich bewegt, und so fragt man sich vielleicht: Wo ist die Substanz? Und manchmal sieht die Bewegung so aus, als würde sie stillstehen, als sei sie eine Mitte, die sich unentwegt wie eine Spirale in sich selbst hineinschraubt, und man fragt beim Lesen: Wo ist der Kontakt zur Welt? Er ist dort, wo mein Nächster kommt und eingreift – mit einem Gedanken, einer Frage, einer Inspiration oder Tat. Die Substanz jeder Buch-Handlung ist immer im Sozialen, im Entstehenden.
Mit dem Thema der Identität hängt auch die Frage zusammen, wo vor diesem Hintergrund die Anthroposophie Rudolf Steiners vom Menschenbild her steht. Es gibt einen Schmerz bei vielen Menschen, der aus anthropologischen Prämissen im Werk Steiners herrührt, die als diskriminierend erlebt werden. Und es gibt einen Schmerz bei vielen mit der Anthroposophie Umgehenden, die als (nicht weniger diskriminierende) Denunziation erleben, was medial mit dem Kontext-Wesen »Anthroposophie « geschieht. Wie kann es hier zu einem wahrhaftigen Gespräch kommen und zu einer respektvollen Verständigung?
Was wir von mitfühlenden (und oft jungen) Menschen jetzt gerade alle lernen, ist dies: Die Enttäuschung und das Misstrauen, die entstehen, wenn sich jemand anmaßt, und sei es aus einer redlichen Absicht heraus, das Wesen eines Schmerzes zu beurteilen, eine Verletzung zu verstehen, eine Unsicherheit zu kennen; das allzu schnelle Vergleichen, abhakende Bewerten und unbefangene Auf-sich-selbst-Beziehen (»Ich selbst bin doch kein Rassist!« – »Ich kenne es auch, ausgegrenzt zu werden!«) – für viele Menschen sind solche Reaktionen, ist diese ernüchternde Erfahrung Alltag. Sie fühlen sich dadurch oft doppelt diskriminiert und entwürdigt, einmal faktisch und dann noch einmal in der Rezeption und Kommunikation der Diskriminierungen. Sie sagen deshalb etwa, zugespitzt und beispielhaft: »Eigentlich kannst Du, weißer alter anthroposophischer Mann, nichts Substanzielles beitragen zu einem Gespräch über rassistische Passagen im Werk Rudolf Steiners, oder über die Angst einer Frau nachts um zwei in einem Parkhaus, Akasha-Chronik hin oder her. Und kommentiere auch nicht meine Krankheit mit allgemeinen Erörterungen über Karma und Schicksal. Bitte sei befangen. Nimm Deine Befangenheit ernst, nimm sie wörtlich, sperre Dich selber aus dem Diskurs aus, geh in Quarantäne und vergifte nicht diesen Frauenbuchladen mit Deiner toxischen Präsenz.«
Ist Identitätspolitik möglicherweise gleichzeitig fort- und rückschrittlich, gleichzeitig aufklärerisch und anti-aufklärerisch? Ist sie ein Wetterleuchten, ein Symptom für die Geburtswehen eines neuen Bewusstseins für die Seelenbewegung des Anderen, ein universelles Ideal, das noch nicht vollständig zu sich selbst erwacht ist und sich daher verzerrt artikuliert – eher trennend, weil lobbybewusst, und noch nicht spirituell verbindend und befreiend?
Adjektivisches Zukunftsbewusstsein
Es bräuchte heute einen Konsens darüber, dass jede Persönlichkeit so vielschichtig ist, dass sie in einem materialistischen Konzept von Individualität und Gesellschaft nie zu fassen sein wird. So liegt in uns die Möglichkeit, sich mit völlig divergierenden Standpunkten identifizieren zu können. (Auch »Corona« spaltet vielleicht nur deshalb, weil wir in uns gespalten sind – aber es nicht sein dürfen.) Dabei ist niemand identisch mit einer Gruppe von damit vielleicht zusammenhängenden anderen Standpunkten (oder Persönlichkeiten). Kontextualisiert werden kann immer nur, was jemand sagt, aber nicht der ganze Mensch: Ich stifte ja erst die Zusammenhänge, in denen ich auftauche, ich bilde und bin sie.
»Ich verbinde mich« heißt: Ich lasse zu, dass ich von nun an mit etwas verbunden und in Beziehung gesetzt werde – ich bin also »verbindlich «. Ich kann es aber gegenüber mehreren Dingen oder Menschen sein. Ich kann sagen: »Ich stimme Dir vollkommen zu«, und wenn ein anderer etwas Konträres äußert, das aber – in diesem Moment – ebenfalls einen wesentlichen Aspekt der betreffenden Sache berührt, dann sage ich den Satz: »Ich stimme Dir vollkommen zu« gleich ein zweites Mal.
Man kann eine gewisse Souveränität und Freiheit darin erkennen, dass Rudolf Steiner es vermochte, im gleichen geschichtlichen Atemzug von den einen als Verräter alles Deutschen und von den anderen als dessen gefährlichster Vertreter betrachtet und verfolgt zu werden. Indizien finden beide Seiten immer. Aber wesentlicher ist, ob wir spüren, wo jemand steht, oder wo er heute stünde, ob wir erspüren, was ihn im Innersten wirklich bewegt hat.
So frage ich mich, ob Steiners geistige Individualität heute nicht eher mit einem echten Zeitinteresse darauf blicken würde, dass manche seiner begrifflichen Ausprägungen und menschenkundlichen Ansätze Menschen unnötig zurückstoßen. Vielleicht wartet dasjenige, was Anthroposophie in ihrem Wesen ist, fortwährend auf ein besseres oder anderes Verständnis, ein wachsendes Sich-Enthüllen. Es ist noch am Sich-Offenbaren, und das tut es nur im Denken, Fühlen und Wollen des Einzelnen, im Ich. Vielleicht geht es heute darum, gerade nicht mit sich selbst identisch zu sein, gerade nicht ein Substantiv zu bilden, als verkopftes Hauptwort, und nicht von, sondern aus der Substanz zu leben und sie im Herzenskontakt zu verwandeln: als Tätigkeit, als Verb, als empathisches Sich-Identifizieren. Vielleicht bereitet sich sogar, trinitarisch gesprochen, das adjektivische Bewusstsein einer Zukunft vor, in der wir einander blind verstehen – auch im Fremden, im Unverständlichen, weil wir uns nahezu alles fragend und begreifend aneignen können und unsere Blindheit in unser Sehen und in unsere Ansichten mit hineinnehmen. Weil unser Bewusstsein des Anderen so tief und so weit ist, dass wir ihn als eine Möglichkeit in uns tragen. Dann werden auch Anthroposophen nicht mehr als solche identifizierbar sein, und das Etikett »Waldorf« wird nur noch an Hüllen haften, die abgeworfen wurden.
Die allererste Frage, die das Erscheinen Jesu aufwarf und die ihm Menschen bis zuletzt immer wieder stellten, die Gelehrten wie das Volk – die Frage, die im Johannes-Evangelium an den Prolog über das Wort anschließt, das im Urbeginn war und von dem es im dritten Vers heißt, alles sei »durch dasselbe« geworden – diese drängendste, tiefste, bis heute lebendigste und stets neu alles entscheidende Frage an das Christus ahnende Menschen-Ich lautet: »Wer bist Du?« (Joh 1,19)
Andreas Laudert, *1969, studierte Szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin sowie Theologie, ist Autor und Waldorflehrer.