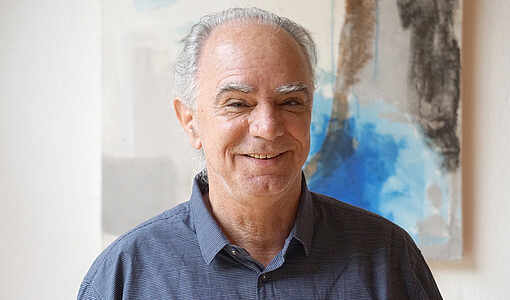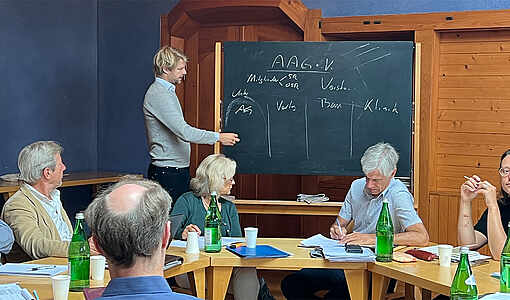Im Gespräch mit Stefan Padberg, Geschäftsführer des Instituts für soziale Gegenwartsfragen, Stuttgart
Das Institut für soziale Gegenwartsfragen, Stuttgart wurde in der Zeit nach der Wende 1989/90 gegründet, einer Zeit, in der Deregulierung, Liberalisierung und Rückbau staatlicher Macht die Debatten bestimmten. Heute ist eine ganz andere Zeit: Staat und Gesellschaft drängen mit Macht zurück auf die Bühne, um die multiplen Krisen zu managen. Das Institut hat sich nach einem Generationswechsel neu aufgestellt und hat seinen Ansatz, anthroposophische Sozialforschung in die gesellschaftlichen Debatten der Gegenwart einzubringen, aktualisiert. Wir haben mit Stefan Padberg, dem Geschäftsführer des Instituts, ein Gespräch geführt. Die Fragen stellte Olivia Girard.
 Foto: Stefan Padberg - Institut für soziale Gegenwartsfragen (Stuttgart)
Foto: Stefan Padberg - Institut für soziale Gegenwartsfragen (Stuttgart) Olivia Girard: Das Institut hat sich neu aufgestellt. Welche Aufgaben werden neu gegriffen, wer sind die Menschen, die mitwirken?
Stefan Padberg: Unsere langjährigen Vorstände, die Gründer des Instituts, Udo Herrmannstorfer und Christoph Strawe, haben sich vor einiger Zeit aus Altersgründen aus der Vorstandsarbeit zurückgezogen. Nachgerückt sind dann Wolfgang Rau, der als Dozent in der Lehrerbildung und als Entwicklungsbegleiter von Schulen vor allem in der Waldorfpädagogik zu Hause ist, sowie der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler André Bleicher, Professor für Strategisches Management und Organisation an der Hochschule Biberach. Auch das Institut leidet wie viele andere Einrichtungen in der breiten Gesellschaft (Kirchen, Gewerkschaften, Parteien, Anthroposophische Gesellschaft) an dem Phänomen der Überalterung, der Abnahme des Unterstützerkreises und der Tatsache, dass es wenig Frauen in verantwortlichen Positionen gibt. Die langjährige Fortbildungsreihe „Individualität und soziale Verantwortung“, mit der vielen Menschen die anthroposophische Sozialforschung nahegebracht worden ist, und zuletzt die regelmäßigen Forschungskolloquien im Forum 3 mussten wir einstellen. Der neue Vorstand setzte sich deshalb zunächst zum Ziel, die Zeitschrift „Sozialimpulse“ auf jeden Fall weiterzuführen. Hierzu musste allerdings ein neues Konzept entwickelt werden.
OG: Mir fällt das neue Erscheinungsbild der „Sozialimpulse“ auf. Was hat sich denn inhaltlich verändert?
SP: Die Zeitschrift soll ein Forum werden, in dem anthroposophische Sozialwissenschaft in einen Austausch auf Augenhöhe mit den transformativen Wissenschaften und Initiativen unserer Zeit tritt. Das Lifting des Layouts ist eine Konsequenz daraus. Eine weitere ist, dass wir von dem an sich sehr sympathischen Modell einer Kostenteilung nach Selbsteinschätzung abgerückt sind und ein ganz normales Abo-Modell aufgesetzt haben. Diese Zeitschrift soll kein Rundbrief mehr sein, bei dem die Leserinnen und Leser die gleichen Grundüberzeugungen teilen und sich solidarisch an den Kosten beteiligen. Wenn wir die Zeitschrift für weitere Kreise in der Transformationsszene interessant machen wollen, dann müssen diese Kreise sie auch beziehen können, ohne sich in unsere Szene begeben zu müssen.
Inhaltlich haben wir keine Berührungsängste mit sozialwissenschaftlichen Forschungsergebnissen aller Art, nutzen sie für unsere Arbeit und stellen sie in der Zeitschrift in der ihnen gemäßen Form dar. Wir haben es auch geschafft, dass die Zeitschrift nun in verschiedenen Hochschulkatalogen aufgeführt ist. Sie ist somit die einzige Zeitschrift mit anthroposophischem Hintergrund, die für den Wissenschaftsbetrieb unserer Zeit auffindbar ist.
OG: Kommen die bisherigen Leserinnen und Leser damit zurecht?
SP: Die Zeitschrift war entstanden als ein Organ zur Vernetzung von Dreigliederern und hat diese Aufgabe in den 1990er-Jahren – knapp vor dem Beginn des Internetzeitalters – sehr gut erfüllt. Auch wenn in den späteren Jahren viele hochkarätige Artikel ihren Weg in die Zeitschrift fanden und sich die Forschungsarbeit von Udo und Christoph in ihr spiegelte, muss man im Rückblick konstatieren, dass die Zielgruppe de facto vor allem im anthroposophischen Umfeld lag. Dies machte es Leserinnen und Lesern anderer Provenienz schwer. Heute ist es umgekehrt: Es gibt gelegentliche Irritationen bei dem eher traditionell ausgerichteten Teil der Leserschaft, der die ihm geläufigen Vokabeln vermisst. Die Rückmeldungen von Nicht-Anthroposophen zeigen jedoch, dass wir für sie verständlich sind und auch verstanden werden.
OG: Welche Projekte stehen für die Zukunft im Raum?
SP: Neben der weiteren Verbesserung und Stabilisierung der Zeitschrift planen wir Forschungsarbeiten zu den Themen „Zusammenarbeit in der Wirtschaft“ und „Wohnen, Mieten, Boden“. Was sich hier realisieren lässt, hängt wesentlich von Stiftungsgeldern ab. Die entsprechenden Forschungsergebnisse würden sich dann auch in der Zeitschrift widerspiegeln.
Wir planen eine Seminarreihe zu aktuellen Themen wie z. B. „Rechtsextremismus“ oder „Transformationspfade in der Klimapolitik“, bei denen man uns vor Ort einladen kann. Die Reisebereitschaft hat seit Corona stark nachgelassen, aber das Bedürfnis nach nicht-digitalem Austausch ist dennoch vorhanden.
OG: Wie finanziert das Institut seine Arbeit?
SP: Das Institut finanziert seine Arbeit rein über Spenden. Auch das Zeitschriftenprojekt ist auf großzügige Spenden angewiesen: Die Einnahmen aus den Abos der „Sozialimpulse“ decken die Ausgaben noch lange nicht. Ohne ideelle und finanzielle Unterstützung, wie es viele Leserinnen und Leser seit vielen Jahren geleistet haben, wird die Zeitschrift weiterhin nicht auskommen. Am 15. Februar haben wir deshalb die Sozialimpulse-Gesellschaft gegründet. Sie soll der engagierten Leserschaft, mit der wir den regelmäßigen Dialog suchen werden, ein organisatorischer Rahmen sein.
OG: Wie kamst Du zur sozialen Dreigliederung und was bedeutet die Arbeit für Dich?
SP: Ich habe die Dreigliederung des sozialen Organismus schon in jungen Jahren kennengelernt, als ich mich in der Anti-AKW-Bewegung engagierte. Allerdings hat es damals nicht „gezündet“. Zu abstrakt erschienen mir die Begriffe, und zu weltfremd die Menschen, die sie vertraten. Dieser Blick von außen, den ich damals hatte, ist mir heute eine Hilfe, wenn es darum geht, zu verstehen, warum viele sozial engagierte Menschen Probleme haben, mit der sozialen Dreigliederung warm zu werden.
Erst mit der Finanzkrise 2007/08 entstand in mir das Bedürfnis, dieses Konzept näher anzuschauen. Für mich war intuitiv klar, dass wir es hier mit einer tiefen Strukturkrise des Kapitalismus zu tun haben, die nicht durch einzelne Initiativen, sei es für direkte Demokratie, Regiogeld, biologische Landwirtschaft oder im Bereich der Pädagogik adressiert werden kann. Deshalb habe ich mich beim Studiengang „Individualität und soziale Verantwortung“ 2010‒2012 angemeldet, der, wie sich dann herausstellte, der letzte war.
Als Christoph sich 2018 aus der Arbeit zurückziehen wollte, hat er mich gebeten, die Redaktion der Zeitschrift und später auch die Geschäftsführung des Instituts zu übernehmen. Wozu ich mich nach langer Überlegung auch bereit gefunden habe.
OG: Viele Menschen kennen Anthroposophie, aber nur wenige die soziale Dreigliederung, woran liegt das?
SP: Das eine ist das Problem der Begrifflichkeit. Darüber haben wir schon gesprochen. Im Rückblick kann man konstatieren, dass eine gewisse Breitenwirkung immer dann zustande kam, wenn man sich anschlussfähig ausdrückte. Das trifft auf so unterschiedliche Initiativen zu wie das Seminar für freiheitliche Ordnung Bad Boll, dem in den 1950er- und 1960er-Jahren ein gewisser Ausbruch aus dem Binnendiskurs gelang, auf Josef Beuys mit seinem „Aufruf zur Alternative“ 1978 und seinem Engagement bei den GRÜNEN, und eben auch auf unser Institut, das in den 2000er-Jahren in der globalisierungskritischen Bewegung im Stuttgarter Raum eine gewisse Bekanntheit und einen gewissen Respekt erlangte.
Ein anderes Problem besteht darin, dass Rudolf Steiner kein sozialwissenschaftliches Grundlagenwerk zur sozialen Dreigliederung verfasst hat wie z. B. für den Bereich der Medizin. Seine Einlassungen stammen aus kleinen Artikeln aus dem 19. Jahrhundert oder aus Vorträgen nach dem Ersten Weltkrieg. Auch seine Schrift „Die Kernpunkte der sozialen Frage …“ ist aus einer Umarbeitung von vier Vorträgen entstanden und von ihm nie als sakrosanktes Lehrbuch betrachtet worden. Dennoch bildeten sich später verschiedene Denkschulen und Interpretationsgemeinschaften, was es Außenstehenden schwer macht, die wesentlichen Konzepte zu erfassen. Hängen bleibt am Ende dann nur „Freiheit im Geistesleben, Gleichheit im Rechtsleben, Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben“.
OG: Wie kann man denn damit umgehen?
SP: Wir stehen hier vor dem Problem einer unklaren sozialwissenschaftlichen Methodik. Eines der wichtigsten Probleme in der Sozialwissenschaft ist die Frage, ob sie die soziale Wirklichkeit nur wertfrei beschreiben oder ob sie auch zu ihrer Veränderung beitragen soll. Dies hat in der Sozialwissenschaft immer wieder zu weit ausgreifenden Debatten geführt. Rudolf Steiner will beides, vorurteilsfrei beschreiben und eine transformative Entwicklung anstoßen, aber er macht hier ganz oft eine Engführung: Wenn man die Gesellschaft unbefangen betrachte, könne man eigentlich nur die Dreigliederung des sozialen Organismus anstreben, sagt er oft sinngemäß. Aus heutiger Sicht bemüht er sich damit nicht genügend darum, die Beschreibung der Wirklichkeit und ihre Veränderung auseinanderzuhalten. Von außen wirkt das dann, als würde Rudolf Steiner grundlegende sozialwissenschaftliche Methodiken nicht beachten. Eine saubere Beschreibung der Forschungsmethodik unter Berücksichtigung und Einbeziehung anderer Denkstilgemeinschaften ist deshalb unabdingbar, wenn man erfolgreich in die Breite der Gesellschaft wirken möchte.
OG: Ist die soziale Dreigliederung einer der Steiner’schen Impulse, der noch nicht realisiert wurde? Gibt es Beispiele für eine gelungene Verwirklichung?
SP: In welchem Sinne kann man von „Realisation“ sprechen? Wir müssen auch hier die deskriptive und die normative Ebene unterscheiden. Auf der deskriptiven Ebene hat Rudolf Steiner mehrfach die These vertreten, dass es im Laufe der historischen Entwicklung der letzten zwei- bis dreitausend Jahre hier in Europa zu einer Abgliederung der drei gesellschaftlichen Funktionsbereiche Geistesleben, Rechtsleben, Wirtschaftsleben voneinander gekommen ist. In diesem Sinne hat sich in der Gegenwart eine funktionelle Dreigliederung realisiert. Dies haben auch andere Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler so gesehen und das bietet viele Anknüpfungspunkte für einen Dialog – was in unseren Kreisen viel zu wenig genutzt wurde und wird.
Auf der normativen Ebene spricht Steiner von der Freiheit im Geistesleben, die zu realisieren sei, genauso von der Gleichheit im Rechtsleben und von der Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben. In den westlichen Demokratien sind diese Werte nach dem Zweiten Weltkrieg oberflächlich gesehen einigermaßen realisiert worden. Aber mit der neoliberalen Globalisierung und der Finanzkrise kam es wirtschaftlich weltweit zu einem bemerkenswerten Roll-back und das Wachstum autoritärer Tendenzen seitdem greift in die verschiedensten gesellschaftlichen Bereiche über. Die wachsende Tendenz zur Militarisierung politischer Konflikte ist ein weiterer Aspekt. Die Ursache liegt letztendlich in der Kommodifizierung, in der Verkäuflichkeit der drei Produktionsfaktoren Natur, Arbeit und Kapital. Hier hatte Steiner sehr weitgehende Vorschläge für die Weiterentwicklung des Eigentumsbegriffs gemacht, die bis jetzt noch nicht in ausreichendem Maße für die soziale Entwicklung fruchtbar gemacht worden sind.
OG: Welche Rolle könnte die soziale Dreigliederung in der Zukunft spielen?
SP: Die große Menschheitsaufgabe der Gegenwart und nahen Zukunft ist die Befreiung des Wirtschaftslebens von einem wachstumsgetriebenen hin zu einem kooperativen, sozialen und nachhaltigen Ansatz. Dies wird nicht gelingen, wenn man die gesellschaftlichen Produktionsmittel im gleichen Sinne als Privateigentum betrachtet, wie man seine eigene Zahnbürste als Privatbesitz ansieht. Dass dies kein Selbstläufer ist, zeigen die aktuellen politischen Debatten in unserem Land, wo man meint, mit den Rezepten der 1980er-Jahre die Probleme des 21. Jahrhunderts lösen zu können. An dem Widerstand gegen eine etwas energischere Klimatransformation wird deutlich, dass es einer umfassenderen sozialen Transformation bedarf, bei der die Menschen in ganz anderer Weise mitgenommen werden müssen. Bisher ist diese Transformation zu sehr als eine Abfolge technologischer Umbaumaßnahmen gedacht worden.
Wir hoffen, als Institut für soziale Gegenwartsfragen bei diesen Debatten mit unserem erweiterten Blick auf das Soziale einen wirkungsvollen Beitrag leisten zu können, wohl wissend, dass es viele andere Akteure weltweit gibt, die auf diesem Feld ebenfalls aktiv sind. Wir sind neugierig und weltoffen genug, um uns diesen Herausforderungen zu stellen.
Stefan Padberg ist in Freiburg (Breisgau) aufgewachsen und hat dort die Alternativbewegungen der 1970er- und frühen 1980er-Jahre mitgemacht (Schüler-, Anti-AKW-, Hausbesetzerbewegung sowie Initiative für ein autonomes Jugendzentrum). Er studierte in Hamburg Informationstechnik und arbeitete als Ingenieur. Nach einer Umorientierung arbeitete er 20 Jahre als Sozialtherapeut in der psychiatrischen Nachsorge. Seit 2012 ist er freiberuflich als Webprogrammierer tätig, seit 2019 ist er Redakteur der Zeitschrift „Sozialimpulse“, seit 2020 Geschäftsführer des Instituts für soziale Gegenwartsfragen, Stuttgart.