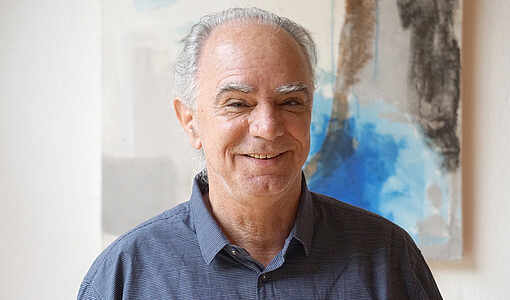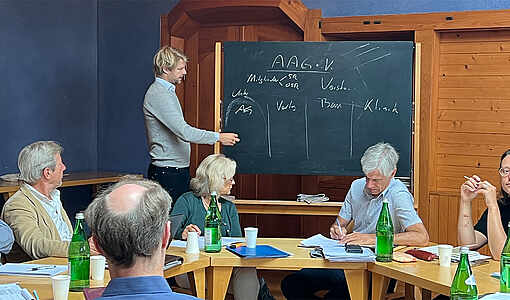Der real existierenden, lebendigen Vielfalt gerecht zu werden
Lea Deffner über ihre Forschungsarbeit zur Geschlechterfrage in Theorie und Praxis
 Lea Deffner
Lea Deffner Man kann es nicht anders sagen: Ich bin Vollblutwaldi. Anthroposophische Praxisfelder prägten nicht nur meine (Waldorf)Schulzeit, sondern auch meine vielfältigen außerschulischen Interessen bis hin zum Studium (B.A. Kunst im Sozialen, Kunsttherapie und M.A. Waldorfpädagogik, Inklusive Pädagogik). Durch den Switch von der erlebten Praxis zur Theorie konnte ich den Wirkweisen der Waldorfpädagogik autoethnographisch und selbstreflexiv nachfühlen. Individualität, Inklusivität und Freiheit waren und sind zentrale Kernpunkte meiner Forschungen. Als ich schwanger wurde, verknüpften sich diese Kernpunkte unweigerlich mit Fragen an das vorherrschende Geschlechtersystem.
Es war für mich bisher nicht problematisch, als „weiblich“ gelesen zu werden, aber die schwangerschaftsbedingten Erwartungen, die aufgrund dieses „Beweises für meine Weiblichkeit“ auf mich einwirkten, ließen mich die ungeheure Macht des binären Geschlechtersystems erst richtig spüren. Bin ich denn nicht immer noch in erster Linie Mensch? In zweiter Linie schwanger? Und dann kommt irgendwann „weiblich“? Oder warum muss diese Zuschreibung „weiblich“ überhaupt kommen? Was soll das über mich aussagen? Dasselbe wie über die halbe Menschheit? Was, wenn ich mich darin nicht wiederfinde? Gibt es für meine geschlechtliche Identität nur zwei Möglichkeiten? Oder eigentlich nur diese eine, die damals in meine Geburtsurkunde geschrieben wurde? Mit welchen Reaktionen muss ich rechnen, wenn ich „aus der Rolle falle“? Was heißt das für das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit? Sind wir denn nicht alle irgendwie „anders“?
In unzähligen Theorien (und Praxen) beschäftigen sich Menschen mit Fragen nach Selbstbestimmung, Authentizität und Vielfalt – auch bezüglich Geschlecht. Ob in Soziologie, Philosophie, Linguistik oder sogar Biologie: Die Auffassung von dem, was Geschlecht ist, wie es entsteht und wirkt, hat sich in jüngster Vergangenheit stark verändert; und zwar weg von einer vermeintlich biologisch determinierten Kategorie, hin zu einem in verschiedensten Wechselwirkungen stehenden, komplexen Konstrukt. Die Grundvoraussetzung für eine wirkliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist allerdings die Bereitschaft uns selbst zu öffnen, loszulassen von allem, was wir bisher für selbstverständlich genommen haben und uns auf diese Verunsicherung einzulassen. Natürlich ist dieser Prozess eng verwoben mit gesellschaftlichen Einflüssen. Und auf uns Anthroposoph_innen wirken nicht nur die heutigen normativen Strukturen, sondern gleichzeitig auch die, denen Rudolf Steiner zu seinen Lebzeiten ausgesetzt war. Es ist außerdem nicht zu vernachlässigen, dass wir durch unser eigenes Handeln – und das meint auch vermeintlich „passives“ Handeln wie bspw. die unreflektierte Zustimmung zu den herrschenden Verhältnissen – wiederum die Gestaltung dieser Gesellschaft prägen. Schon seit frühester Kindheit tun wir alles, um uns zugehörig und respektiert zu fühlen, auch wenn wir dafür Teile unserer Individualität und Freiheit einbüßen müssen.
Die oben genannten Kernpunkte werden auch in dieser Arbeit, der ich mich dank des Stipendiums der AGiD widmen kann, eine zentrale Rolle spielen. Es geht mir um die Philosophie der Freiheit: um deren praktische Umsetzung und individuelle Erlebbarkeit. Ich untersuche Haltungen, die im Umgang mit Kindern und Jugendlichen zukunftsfähig sind, den individuellen Weg ihrer geschlechtlichen Identitäten respektieren und ihnen Freiräume zur Entfaltung lassen. Die Ergebnisse möchte ich dann in Konzepte zur „Aufklärung“ von Heranwachsenden und Pädagog_innen gießen.
Um sich den Praxisbezug einer solchen Haltung vorstellen zu können, möchte ich kurz ein Gedankenspiel skizzieren: In der Waldorfpädagogik gibt es bekanntlich einige „Modelle“, die der Beschreibung von Kindern und Jugendlichen dienen sollen, z.B. die Temperamente (phlegmatisch, cholerisch etc.). Die Zuordnung zu den Temperamenten ist stets beweglich, niemals endgültig, wird reflektiert und achtsam kommuniziert. In der Anwendung können sie jedoch auch leicht zu eindimensionalen Kategorien werden. Mit den Geschlechtern ist das ähnlich. Es kann schon allein eine Reflexion über die Anwendung zu einem offeneren Umgang mit unseren Mitmenschen führen.
Ich arbeite also für eine Welt, in der alle frei und selbstbestimmt leben können, ohne verurteilt, pathologisiert, belächelt oder verletzt zu werden. Es hilft zu fragen, wer dabei die Deutungshoheit beansprucht. Die Möglichkeit, dass wir uns einer Norm anpassen können, erlaubt uns nicht, über die Menschen zu urteilen, die das nicht wollen oder können. Ich möchte einen Perspektivwechsel anregen, weg von den Einschränkungen vermeintlicher Regeln und Stereotypen, hin zum aufmerksamen Zuhören und neu ausgeloteten Miteinander auf Augenhöhe. Es ist mir wichtig zu betonen: Es geht hier nicht um die „Unnormalen“, sondern darum, der real existierenden, lebendigen Vielfalt endlich gerecht zu werden!
Literatur:
- Barker, Meg-John & Scheele, Julia 2018: Queer – Eine illustrierte Geschichte. Münster: Unrast Verlag.
- Hornscheidt 2019: Exit Gender – Gender loslassen und strukturelle Gewalt benennen: eigene Wahrnehmung und soziale Realität verändern. Berlin: w_orten & meer Verlag.
- Steiner 1894: Die Philosophie der Freiheit – Grundzüge einer modernen Weltanschauung, GA4. Dornach: Rudolf Steiner Nachlassverwaltung.
- Voß 2018: Geschlecht – Wider die Natürlichkeit. Stuttgart: Schmetterling Verlag.